Linke-Spitzenkandidaten über Europawahl: „Die Partei lebt“
Carola Rackete ist Berufsaktivistin, Martin Schirdewan Berufspolitiker. Für Die Linke wollen sie bei der Europawahl ein gutes Ergebnis einfahren.

Carola Rackete und Martin Schirdewan Foto: Daniel Chatard
wochentaz: Frau Rackete, ist Ihre Kandidatur für das EU-Parlament eine Art Seenotrettungsmission für Die Linke?
Carola Rackete: Meine Nominierung verstehe ich als ein Zeichen, in welche Richtung Die Linke gehen will, etwa in Sachen Klima- und Migrationspolitik. Aber auch der Weggang von Sahra Wagenknecht hat den Weg freigemacht, damit Leute, die sich nicht mehr mit der Linken identifizieren konnten, wieder zurückkommen. Dadurch besteht nun die Chance auf eine Erneuerung.
Sie kandidieren als Parteilose. Warum sind Sie nicht Mitglied der Linkspartei geworden?
Rackete: Ich sehe meine Parteilosigkeit als einen Vorteil, weil ich darüber besser mit Menschen ins Gespräch kommen kann, die sich zwar als Teil der gesellschaftlichen Linken sehen, aber sich nicht unbedingt mit Parteipolitik identifizieren. Oder noch zweifeln, ob sie jetzt Die Linke als Partei wählen sollen.
36, Naturschutzökologin, nahm an weltweiten Forschungsmissionen teil. 2019 wurde sie als Kapitänin der „Sea-Watch 3“ international bekannt, nachdem sie mit 53 Geflüchteten an Bord unerlaubt den Hafen von Lampedusa anlief. Bei der Europawahl 2024 tritt sie gemeinsam mit Martin Schirdewan als parteilose Spitzenkandidatin für Die Linke an.
Auf dem taz lab nannten Sie als Beweggrund, Nautik zu studieren, bloß keinen Bürojob machen zu wollen. Jetzt streben Sie genau diesen an. Warum?
Rackete: Ich muss zugeben, dass meine Vorstellungen von der Seefahrt auf einem Irrtum basierten. Denn am Ende habe ich mich in einem Büro mit sehr vielen Fenstern wiedergefunden, das auf dem Wasser geschwommen ist. Und genau dort wurde ich politisiert: Ich habe auf einem Forschungsschiff gearbeitet und war schockiert, wie frustriert die Wissenschaftler dort waren. Denn nichts von dem, was politisch aufgrund ihrer Datenlage zur Klimakrise hätte umgesetzt werden müssen, wurde getan.
Martin Schirdewan: Wer Politik als reinen Bürojob auslegt, macht ohnehin etwas grundlegend falsch. Man muss raus zu den Leuten, ihnen zuhören und mit ihnen diskutieren. Auch dorthin, wo es dann eventuell mal wehtut.
Herr Schirdewan, in den Umfragen steht Die Linke zwischen 2 und 4 Prozent. Haben Sie sich nicht mehr erwartet von Carola Racketes Kandidatur?
Schirdewan: Na ja, die Auseinandersetzungen in der Vergangenheit und die schwierige Situation, in der sich die Partei befindet, lassen sich ja nicht einfach mit einer Kandidatur von wem auch immer reparieren. Wir sind da auf einem längeren Weg. Wichtig finde ich das Signal, dass Die Linke sich für die gesellschaftliche Linke öffnet.
Trotzdem befindet sich Ihre Partei weiter in einer schweren Krise.
48, steht seit 2022 gemeinsam mit Janine Wissler an der Spitze der Linkspartei. Er gehört zum Reformerlager der Partei. Der in der DDR aufgewachsene Politikwissenschaftler gehört seit 2017 dem EU-Parlament an und ist dort seit 2019 Co-Vorsitzender der Linken-Fraktion. Bei der Europawahl 2024 tritt er gemeinsam mit Carola Rackete als Spitzenkandidat der Linkspartei an.
Schirdewan: Die Partei lebt. Sie ist dabei, sich auf sich selbst und ihre Rolle als konsequente Gerechtigkeitspartei zu besinnen. Es ist ja klar, dass wir nicht zufrieden mit den derzeitigen Umfrageergebnissen sind. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir ein gutes Ergebnis bei diesen Europawahlen erzielen werden. Und zwar deshalb, weil wir jetzt wieder Klarheit haben, wofür Die Linke steht: für soziale Gerechtigkeit, für sozialen Klimaschutz, für Solidarität in der Gesellschaft, für Antifaschismus. Wir nehmen als Einzige im Bundestag kein Geld von Konzernen und legen uns mit den Reichen und ihren Lobbyisten an.
Was wäre für Sie ein gutes Ergebnis?
Schirdewan: Wir haben im Moment fünf Abgeordnete. Ich möchte gerne, dass wir weiterhin mindestens fünf Abgeordnete haben werden.
Wie wird sich die Linkspartei verhalten, wenn das Bündnis Sahra Wagenknecht nach der Europawahl den Antrag zur Aufnahme in die Linksfraktion im EU-Parlament stellen sollte? Beispielsweise sind aus Portugal mit dem linkssozialistischen Bloco und der kommunistischen PCP ja auch zwei Parteien dabei, die sich gegenseitig hassen.
Rackete: Einen solchen Antrag kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Schirdewan: Ich sehe keine Zukunft für das BSW in der Linksfraktion, weil es keine linke Partei ist und auch nicht sein will. Das ist der zentrale Unterschied zu den von Ihnen erwähnten portugiesischen Parteien. Das BSW steht für ressentimentgetriebenen Populismus. In entscheidenden politischen Fragen ist eine Zusammenarbeit nicht möglich, schon gar nicht in einer Fraktion.
Seit ihrer Gründung gab es in der Linkspartei einen Grundkonflikt um ihr Verhältnis zur EU: Die einen verorteten sich proeuropäisch, die anderen antieuropäisch. Halten Sie diese Frage mit dem Abgang von Wagenknecht und ihrem Anhang nun für geklärt?

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.
Schirdewan: Ja, dieser Grundkonflikt ist in der Partei seit längerem geklärt. Spätestens nach dem Brexit ist der Euroskeptizismus von Parteien wie der AfD oder dem BSW, der bis hin zu Forderungen nach einem Dexit geht, nur noch hanebüchen. Wenn sich Deutschland aus der EU verabschieden würde, blieben die sozialen Kämpfe dieselben. Und Großbritannien lehrt, dass die Ungleichheit weiter und noch brutaler anwachsen würde. Das heißt aber absolut nicht, dass in der EU alles in Ordnung ist, insbesondere wenn es um soziale Rechte und die öffentliche Daseinsvorsorge geht. Oder wenn man sich den Asyl- und Migrationspakt ansieht, der Menschenrechte an den EU-Außengrenzen beerdigt und das individuelle Recht auf Asyl de facto abschafft. Wenn etwa die Wettbewerbsregeln dazu führen, dass sozialer Wohnungsbau verhindert und Ursula von der Leyen vorschreiben will, dass unser Gesundheitssystem weiter privatisiert wird und profitorientiert arbeiten soll, dann müssen die Regeln geändert werden.
Frau Rackete, ist es für Sie nachvollziehbar, dass in der Linkspartei lange darum gestritten wurde, ob es nicht besser sei, die EU zu zerschlagen?
Rackete: Das ist nie eine Frage für mich gewesen. Ich kann mir nicht einen einzigen Vorteil vorstellen, den es für uns haben könnte, wenn Deutschland die EU verlassen würde. Während der Zeit der Brexit-Abstimmung war ich oft in Großbritannien und habe dort auch gearbeitet. Ich habe die Propaganda und Lügen mitbekommen, mit denen für den Austritt geworben wurde. Das war schlimm. Und heute geht es den meisten Leuten in Großbritannien schlechter als vor dem Brexit. Wichtig finde ich jedoch, dass die EU deutlich demokratischer und transparenter wird. Mich stört zum Beispiel, dass das Europäische Parlament, was ja als einzige EU-Institution direkt gewählt ist, eine schwächere Position hat als der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs oder die Europäische Kommission und kein Initiativrecht hat.
Wie erklären Sie sich, dass die Rechte gerade europaweit im Aufwind ist und dass es den linken Parteien offenbar nicht gelingt, die Menschen abzuholen?
Rackete: Die Rechte hat es natürlich einfacher, indem sie populistisch Migranten die Schuld gibt, für alles, was in der Gesellschaft nicht funktioniert. Die Linke legt sich mit den Konzernen und ihrer Lobby an, statt nach unten zu treten. Die Menschen erleben aber seit Jahrzehnten, dass die Reichen immer reicher werden. Sie haben oft den Glauben verloren, dass es gelingen kann, eine Umverteilung von oben nach unten durchzusetzen.
Schirdewan: Da müssen wir tatsächlich ran. Aber ich stehe auch nicht auf Selbstverzwergung. Wir haben schon einiges erreicht. Wir waren die Ersten, die im Europäischen Parlament eine Gaspreisbremse gefordert haben, das Gleiche gilt für die Übergewinnsteuer. Erst auf unseren Druck hin wurden diese Dinge dann auch vom Parlament beschlossen. Darauf können wir aufbauen.
Ein weiteres Thema, mit dem sich die Linkspartei schwertut, ist der Umgang mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Lehnen Sie weiterhin jegliche militärische Unterstützung des überfallenen Landes ab, Herr Schirdewan?
„Europaweit gibt es einfach einen massiven Rechtsruck. Das ist eine große Gefahr, der wir uns entgegenstellen müssen.“
Schirdewan: Wir sind eine Antikriegspartei. Daher drängen wir immer auf friedliche Konfliktlösung und wollen zivile Alternativen zum militärischen Tunnelblick stärken. Selbstverständlich verurteilen wir den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, ist doch logisch. Aber wenn Sie mir sagen, dass die einzige Möglichkeit ist, immer weiter Waffen zu liefern, dann halte ich das für falsch. Ich will, dass endlich politisch gehandelt wird, um diesen Krieg diplomatisch zu beenden. Es wissen doch alle, dass letztendlich nur Verhandlungen zum Frieden führen werden.
Aber Sie wissen doch auch, dass ohne militärische Unterstützung die Ukraine bald höchstens noch über ihre Kapitulation wird verhandeln können.
Schirdewan: Natürlich wird ein Krieg mit Waffen geführt. Aber das Dilemma besteht doch darin, dass der Krieg immer weiter fortgesetzt wird – wovon übrigens die Rüstungskonzerne massiv profitieren. Wir müssen viel mehr darüber reden, wie der Krieg beendet werden kann. Es ist ein schweres Versäumnis, dass es keine ernsthaften Friedensinitiativen mit Ländern wie China und Brasilien gibt, die Druck auf Putin ausüben können. Das ist auch unsere zentrale Kritik daran, wie die Bundesregierung oder die Europäische Kommission mit diesem Krieg umgehen. Meine Solidarität mit der Ukraine ist unbenommen. Deswegen unterstützen wir auch gezielte Sanktionen gegen Oligarchen und gegen den militärisch-industriellen Komplex.
Frau Rackete, Sie befürworten eine militärische Unterstützung der Ukraine, oder?
Rackete: Ich finde es richtig, der Ukraine Defensivwaffen zur Verteidigung zu liefern, beispielsweise Raketenabwehrsysteme. Die Ukraine ist ein souveräner Staat, sie hat das Recht, sich zu verteidigen.
In der Linkspartei gibt es gerade unter den älteren Mitgliedern ein recht idealisierendes Verhältnis zu Russland. Können Sie das nachvollziehen?
Rackete: Mögliche Wunschvorstellungen oder historische Bezüge zur Sowjetunion haben nichts mit der Realität des jetzigen Russland unter Putin zu tun. Russland hat sich politisch in eine vollkommen falsche Richtung entwickelt. Ich habe 2014 in einem russischen Nationalpark einen siebenmonatigen Freiwilligendienst gemacht, bis heute habe ich Freunde in Russland. Der Druck auf sie ist enorm groß, sobald man sich politisch äußert. Da kommt schnell mal der Geheimdienst vorbei. Russland ist heute eine Diktatur, da darf man sich nichts vormachen.
Beim Wahlkampfauftakt der Linkspartei in Berlin haben Sie gesagt, Ihre Freunde in Chile und Südafrika wüssten, dass man für eine Revolution etwas anzünden müsse. Auch Sie wollten „immer noch etwas anzünden“. Was denn?
Rackete: Das Feuer des antifaschistischen Widerstands. Europaweit gibt es einfach einen massiven Rechtsruck. Das ist eine große Gefahr, der wir uns entgegenstellen müssen. Es ist enorm wichtig, die Leute davon zu überzeugen, sich zu engagieren. Dazu zählt übrigens auch, zur Wahl zu gehen und links zu wählen.




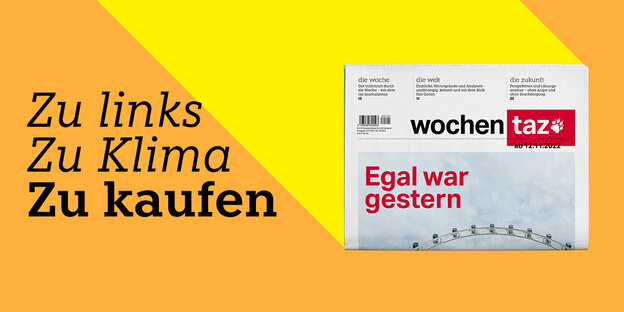



Leser*innenkommentare
Hans aus Jena
Ich nehme die "Die Linke" im Europawahlkampf kaum war. Ihr gelingt es kaum, eigene Themen zu setzen, genauso aggressiv gegen das BSW auftzutreten wie es das BSW umgedreht macht und ihre Verankerung vor Ort, gerade im Osten wie hier in Jena, wo sie bei der letzten Kommunalwahl mit kanpp 20% die stärkste Partei war. Sie ist auch hier vor Ort zerstritten zwischen Leuten, die sich kaum noch von der CDU unterscheiden und denjenigen, die noch linker und hipper als die Bündnisgrünen sein wollen. Ein Pragmatismus, wie man als linke Partei in Kooperation mit anderen (so wie es Ramelow auf Thüringer Landesebene zumindest in den ersten Jahren vormachte) ist kaum noch zu spüren. Ja , die BSW macht ihnen das Leben schwer, insbesondere weil das BSW und SW insbesondere wegen Clickbaits von den Medien hofiert werden. Klare Kante gegen die und eigene pragmatische Vorschläge helfen. Ein Nachplätschern (wie bei den Positionen zur Ukraine) dagegen nicht.
Arno Dittmer
Nur mal so eine alte Weisheit für die Träumer oder Russland Unterstützer der Links Partei:
Zum Krieg braucht es einen, zum Frieden zwei.
Russland hat mit seinem Überfall doch gezeigt, dass es keine zwei braucht.
Alex_der_Wunderer
@Arno Dittmer ...braucht es nicht mindestens zwei Systeme & verschiedene Ideologien ....
Farang
"Die Partei lebt" - so lange sie das unter 5% tut habe ich keine Probleme damit... 😂
Nein ohne Spaß, die AfD als russlandhörige Partei ist Zumutung genug in Bundes- und Landtagen, da braucht es kein BSW und auch keine Die Linke zusätzlich als Putinversteher, danke.
Sätze wie "Ich will, dass endlich politisch gehandelt wird, um diesen Krieg diplomatisch zu beenden. Es wissen doch alle, dass letztendlich nur Verhandlungen zum Frieden führen werden." zeigen wie abgekapselt und realitätsverweigernd auf höchsten Ebenen in dieser Partei gedacht wird.
Ja, natürlich wird auch dieser Konflikt irgendwann über Verhandlungen beigelegt werden müssen, aber dazu müsste ein Putin gesprächsbereit sein - auf realistischer Basis - ist er aber nicht.
Puh, das ist jetzt irgendwie blöd Herr Schirdewan, weil Verhandlungen bedürfen des Dialogs... Wenn eine Seite aber partout Maximalforderungen als unverhandelbar darstellt wirds eng mit Diplomatie 🤷♂️
Aber Herr Schirdewan, sie können ja einfach mal den Anfang machen und nach Moskau fliegen. Wenn es anscheinend so einfach ist mit Putin ins Gespräch zu kommen und auf vernünftiger Basis Verhandlungen zu führen, dann bitte voran - das wäre doch mal ein echter Coup UND tatsächlich gemachte Politik statt ewig leerer Phrasen - das würde sich auch für ihre Partei sicherlich positiv an der Wahlurne bemerkbar machen 🗳
Abdurchdiemitte
@Farang Wenn Sie lediglich unterstellte Putin-Nähe zum alleinigen Kriterium der Wählbarkeit von Parteien machen wollen bzw. die Positionierung zum Ukrainekrieg zu DEM alleingültigen Maßstab der Zustimmung zu linker Politik, dann ist das ungefähr so eindimensional, wie am rechten Rand des politischen Spektrums die Bekämpfung der Fluchtmigration zum zentralen politischen Thema erhoben wird.
Ja, Frau Racketes Position, der Ukraine sollten nur Defensivwaffen zur Verteidigung zur Verfügung gestellt werden, mag man als falsch oder naiv verurteilen - aber daraus irgendeine Verbundenheit mit dem russischen Regime unterzuschieben, ist geradezu infam, übelste Kalte-Kriegs-Rhetorik.
Wenn es der Linken nicht gelingt - auch in diesem taz-Interview mit Rackete und Schirdewan nicht - die inhaltlichen Unterschiede zur AfD und zum BSW herauszustellen, mag das auch an der fehlenden Bereitschaft mancher Diskussionsteilnehmer zur differenzierenden Wahrnehmung liegen.
Also eher Ihr Problem als eines der Linkspartei.
Farang
@Abdurchdiemitte Die konstant fortwährenden Umfragewerte der Linken zwischen 2 und 4% seit dem Austritt von Frau Wagenknecht und ihrem Gefolge sagen mir irgendwie, dass ich nicht ganz alleine damit bin "die inhaltlichen Unterschiede" oder überhaupt irgendein Profil bei der Linken wahrnehmen zu können... 🤷♂️
Also doch eher ein Problem der Partei und weniger meins 😉
Hubertus Behr
Bin mal gespannt, wie lange es Frau
Rackete mit ihrem klugen unabhängigem Kopf in dieser durch und durch dogmatischen Partei
aushält bzw. umgekehrt.
mdarge
@Hubertus Behr ..das Gute, es ist Europawahl. Dort bilden sich die Fraktionen erst nach der Wahl. So hat sich Nico Semsrott von Die Partei sich der Fraktion der Grünen angeschlossen. Soetwas geht auch während der Legislatur. Wenn sich die Linken zuerst anderswo zuordnen, kann Rakete später ihren eigenen Weg gehen.
Jim Hawkins
"Aber wenn Sie mir sagen, dass die einzige Möglichkeit ist, immer weiter Waffen zu liefern, dann halte ich das für falsch. Ich will, dass endlich politisch gehandelt wird, um diesen Krieg diplomatisch zu beenden."
Putin so:
"Sollen wir verhandeln, nur weil denen jetzt die Munition ausgeht?“
www.derwesten.de/p...j-id300880859.html
Brasilien und Indien sollen's richten, das ist alles so lächerlich.
Hätte diese Partei reale Macht, dann wäre die Ukraine schon ein ganzes Stück näher am Abgrund.
Michael Wolffsohn sagte im Hinblick auf den Krieg in Gaza:
"Manchmal muss man töten, um das Morden zu beenden."
Das gilt für den Krieg in der Ukraine nicht weniger. Dem Krieg ist es egal, ob die Linke für oder gegen ihn ist.
Abdurchdiemitte
@Jim Hawkins Das Wolffsohn-Zitat müsste man freilich noch um einen wesentlichen Zusatz erweitern, damit es Sinn macht: es geht wohl nicht um blindwütiges, sinnloses Töten, um Kriegsverbrechen, gar Völkermord - ich unterstelle mal, dass es Wolffsohn SO eben nicht meinte -, sondern immer um das, was moralisch (noch) verantwortet werden kann.
Die Frage des Tyrannenmordes fällt m.E. beispielsweise in diese Kategorie des Verantwortbaren, Notwehr sowieso, in diesem Kontext auch das Recht der Ukrainer auf militärische Verteidigung vor der russischen Aggression - diese Erwägung machte mich persönlich übrigens von einem grundsätzlichen Pazifisten zu einem Befürworter der militärischen Unterstützung der Ukraine.
Frau Rackete leitet aus diesem Grundsatz offenbar ab, dass der Ukraine nur Defensivwaffen geliefert werden sollten - das kann man als unrealistisch oder naiv kritisieren, man sollte dieser Position in der Debatte allerdings keine Putin-Versteherei unterstellen. Es ist etwas grundsätzlich anderes als das, was seitens der AfD und aus dem Wagenknecht-Lager kommt. So viel Differenzierung sollte schon sein.
Ansonsten plädiere ich schon sehr eindringlich dafür - Wolffsohn würde mir da wohl nicht widersprechen - das Gebot “Du sollst nicht töten” nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen und weiter zur Richtschnur ethischen Handelns zu erheben, nicht nur im persönlichen Bereich, auch in den internationalen politischen Beziehungen - bevor noch das Tor zur Hölle geöffnet wird.
Jim Hawkins
@Abdurchdiemitte So wie es aussieht, ist das Tor zur Hölle für viele Menschen in der Ukraine bereits geöffnet.
Selenskij beklagt, dass die Ukraine nur ein Viertel der benötigten Luftabwehrsysteme hat, die es benötigt.
Die Russen rücken vor und es sieht nicht gut aus. Niemand, ein Diktator erst recht nicht, hat in so einer Situation Gesprächsbedarf.
Geht das so weiter, wird es finster enden. Das kennt man ja schon. Mord, Folter, Vergewaltigung, Zerstörung.
Und eine Fluchtbewegung, gegen die die bisherige ein Witz sein wird.
Dazu Machtverschiebung und die Gefahr weiterer Angriffe auf andere Länder.
Ich unterstelle weder der Partei, noch Frau Rackete eine Nähe zu Putin, nur eine realitätsblinde Naivität.
Und ich freue mich riesig, wenn ich mit alledem falsch liege.
tomás zerolo
@STAVROS
Die linke Gruppe im Bundestag ist die einzige, die sich gegen die Diätenerhöhung im nächsten Juli stellt.
Nur so.
DiMa
"Die Partei lebt." Ist das eine Aussage oder nicht eher Teil eines Gebetes? Wo ist das Amen?
Für die gesellschaftliche Linke wäre es aus meiner Sicht besser, die Partei die Die Linke würde sterben und Platz für etwas Neues schaffen. Die Argumente hierfür liefern die eigene Spitzenlandidatin, die ja selbst nicht Teil der Partei sein möchte.
mdarge
@DiMa Wenn schon Gebet, dann:"Die Hoffnung stirbt zuletzt." Ein Vorsitzender, der nicht an seine eigene Partei glaubt, hätte den Job verfehlt. Es klingt durchaus wie Pfeifen im Walde. Würden Inhalte zählen, hätten, Volt, Tieschutz und Mera25 das bessere (Europa-)Programm. Da es keine 5% Hürde gibt, sollte man das wählen, wo man sich besser vertreten fühlt.
Agarack
Ich werde bei dieser Wahl, nach fast 20 Jahren Mitgliedschaft in der Partei, erstmalig nicht die Linke wählen. Ich halte Carola Rackete aufgrund ihrer eigenen Aussagen und Selbstbeschreibungen für ungeeignet, das Amt, das die anstrebt, auszuüben. Wer "keinen Schreibtischjob" machen will, gehört nicht in ein Parlament. Das Interview mit ihr bei Thilo Jung ist sehenswert - es gelingt ihr dort trotz eines ihr offenkundig sehr gewogenen Moderators nicht, zu überzeugen.
Dass Martin Schirdewan zudem meint, ohne Wagenknecht kämen jetzt ganz viele neue Leute zur Linken, halte ich für absurd. Ich bin kein besonderer Wagenknecht-Fan (nach der Coronapandemie wäre das als Arzt auch schwer), aber eine Linke, in der Leute mit Wagenknechts Ansichten keinen Platz haben, ist geschwächt. Der Parteivorstand hat in den letzten Jahren versagt, indem er sie und ihre Anhänger praktisch aus der Partei gemobbt hat - gleichzeitig aber nicht Jahre zuvor eine klare Distanzierung von ihr vorgenommen hat. Der Schlingerkurs führte in eine absehbare Katastrophe, an deren Ende der Parteivorstand jetzt auch noch eine Ehrenrunde dreht, weil man es ja endlich geschafft hätte, die "Bösen" alle loszuwerden. Die Bubble an linksintellektuellen Großstadtlinken, die man sich jetzt wünscht, ist aber a) zu klein und hat b) ohnehin zu viele politische Heimaten (die Grünen, Volt etc.) - die Linke mit ihren Traditionen ist für diese Gruppen eher weniger attraktiv. Ich möchte zudem auch nicht in einer Partei rumhängen, die sich an vielen Stellen gar nicht mehr die Mühe macht, überhaupt konkrete Konzepte zu irgendwas zu entwerfen. Die EU ist auf allen Ebenen schlecht und defizitär, aber man ist klar proeuropäisch? Tolles Konzept.
Budzylein
Die Linkspartei findet also so ziemlich alles an der EU schlecht, einschließlich des strukturellen Demokratiedefizits (zu wenig Macht des Parlaments), will aber unbedingt drin bleiben, weil die EU deutschen Interessen dient. Zusammengefasst: Inkonsequenz aufgrund nationaler Zuverlässigkeit. Toll.
Klingbeil
@Budzylein Wo lesen Sie "deutsche interessen" von den beiden Interviewten? Das gehört doch eher in das Vokubular und Denken ds BSW. Sie verweisen lediglich darauf, dass der Brexit zeigt, dass es nach einem Austritt nicht automatisch besser wird. Aber natürlich kann man kritisieren, dass sie die EU für soweit reformierbar halten, dass die grundlegenden Defizite positiv gedreht werden könnten. Das ist aber eine andere Geschichte.
Budzylein
@Klingbeil Ich meine die Aussage von Rackete, sie könne sich keinen einzigen Vorteil vorstellen, den es für "uns" haben könnte, wenn Deutschland die EU verließe.
LeSti
"Wir müssen viel mehr darüber reden, wie der Krieg beendet werden kann. Es ist ein schweres Versäumnis, dass es keine ernsthaften Friedensinitiativen mit Ländern wie China und Brasilien gibt, die Druck auf Putin ausüben können."
Danke. Bleibt unwählbar. Wir müssen reden? Mit wem? Putin? Der will aber nicht. Versäumnis von wem? Uns? Dass China jetzt blöderweise Putin hofiert? Realitätsverweigerung kommt auch ohne Wagenknechte immer noch ganz oben auf der to Do Liste.
Bussard
@LeSti So ist es. Die haben immer noch nicht verstanden, wie die Lage aussieht.
Lichtenhofer
Martin Schirdewan: "... ein schweres Versäumnis, dass es keine ernsthaften Friedensinitiativen mit Ländern wie China und Brasilien gibt ...". ?.
Sehr geehrter Herr Schirdewan, wenn Sie immer noch nicht gemerkt haben, dass China am Frieden für die Ukraine nicht interessiert ist, sondern am grausamen russischen Eroberungskrieg wesentlich mitprofitiert, weshalb alle Friedensinitiativen in dieser Richtung daher regelmäßig ins Leere abgelenkt werden und dass es sich seitens Brasilien und z.B. Indien ähnlich verhält: dann kann ich Ihnen mit meiner Wählerstimme auch nicht weiterhelfen. Sie würde so auch nur ins Leere laufen.
Samvim
Schon Bud Spencer wusste:" So wird das nix!"
Don Geraldo
Danke für das Gespräch.
Es ist offensichtlich, daß beide Personen nicht viel wahrnehmen außerhalb ihrer eigenen Blase.
Ob nach dem absehbaren Wahldebakel ein Umdenken einsetzt?
Hubertus Behr
@Don Geraldo M.Schirdewan: „Politiker müssen immer
draußen beim Bürger sein“ oder so
ähnlich. Mein Blick heute in die
Wahllisten zum Europaparlament:
zT. völlig unbekannt, jedenfalls alles
andere als bürgernah. Schirdewan
verwechselt Talkshows mit Bürgernähe,
Uranus
"Aber Sie wissen doch auch, dass ohne militärische Unterstützung die Ukraine bald höchstens noch über ihre Kapitulation wird verhandeln können."
Die Kriegspositionierung (der Linken) interessiert mich auch. Gut, dass Sie so kritisch Nachhaken! Und gut auf den Punkt gebracht.
An sich bin ich gegen Militär. Gegen Autokrat*innen und Angriffskriege sehe ich aber das Durchziehen von Pazifismus als utopisch an. Das kann auch schnell einen Zynismus-Dreh kriegen, so wie Sie es auch andeuten. Diskutiert müsste allerdings, welche Waffen geliefert werden sollten. Problematisch bleiben jedoch in meinen Augen allgemein Militarisierung, (private) Rüstungsindustrie und Waffenexporte (insbesondere an Saudi Arabien, Türkei ... und Rüstungsgüter, die in Bürger*innenkriegen eingesetzt werden können). Auch die deutsche Politik diesbezüglich finde ich kritisch.
oricello
Find ich gut, die beiden und wofür sie sich stark machen. Ihre Positionslichter sind gut zu erkennen und geben Orientierung. Danke für euer Interview.
Stavros
Es gibt ein paar Punkte, die ich mir von der Linken wirklich wünschen würde:
1. Dass der Pluralismus der Meinungen, wie sie Racketes Äußerungen zum Ukrainekrieg zeigen, in der Partei gelebt wird.
2. Dass die programmatischen Überzeugungen, die ich im Wesentlichen teile, wirklich in mühevoller Kleinarbeit umgesetzt und durchdacht werden. Und dass nicht umgefallen wird wie in der ersten rot-roten Koalition unter Wowereit und auf einmal neoliberale Reformen mit bis heute katastrophalen Auswirkungen (z.B. auf dem Wohnungsmarkt) mitgetragen werden.
3. Und, am Wichtigsten: Dass die Linke wirklich eine Graswurzelbewegung wird und z.B. von der KPÖ lernt. Das hieße, Verzicht auf Diäten, die über das Durchschnittsgehalt hinausgehen. Lösung konkreter Probleme konkreter Menschen. Echte Ansprechpartnerin sein.
Ganz ehrlich: Ich sehe keine solche Präsenz der Linken in den Mühen der Ebene in meiner Region.
Wenn es sie aber nicht gibt, sind die Linken eine austauschbare Partei wie alle anderen.
mdarge
@Stavros Es gibt sie längst, die anderen Parteien, die alle drei Punkte bedienen. Einfach den Wahl-O-Mat und nach den eigenen Interessen wählen, statt darauf zu schauen, wer sich für welche Koalition eignet. Bündnisse finden sich nach der Wahl.
Stavros
@mdarge Es geht mir weniger um Programmatik, sondern mehr um Umsetzung.
Für mich muss eine linke Partei eine "Kümmerpartei" sein wie die Linke/PDS es früher im Osten war. Oder wie die KPÖ in Graz. Oder wie ganz früher mal die Sozialdemokraten vielleicht.
Nah an den Sorgen der Menschen und Alltagsarbeit.
Warum bietet die Linke nicht zum Beispiel Beratungen für Mietende oder Sozialberatungen an? Warum hilft sie nicht prekarisierten Beschäftigten, sich zu organisieren?
Ich stimme mit der Programmatik der Linken (neben einigen anderen Parteien auch beim Wahlomat) im Wesentlichen überein.
Ein Programm allein hilft aber nicht, wenn man dann z.B. in Berlin den städtischen Wohnungsbestand verkauft.
Ich beobachte heute vor allem endlose, sehr ideologisch geführte Debatten - and no action :-).
Limonadengrundstoff
@Stavros Darf ich fragen, in welcher Region du lebst?
Stavros
@Limonadengrundstoff Berlin Brandenburg. Und du?
tomás zerolo
Meine Stimme habt Ihr.