Matthias Kirschner zu Linux und Co.: "Die Kosten sind wichtig"
Bei Endanwendern sind geschlossene Systeme wie Windows und MacOSX weiter beliebter als Linux-Systeme, sagt Freie-Software-Aktivist Kirschner. Googles Betriebssystem ist auch keine Lösung.
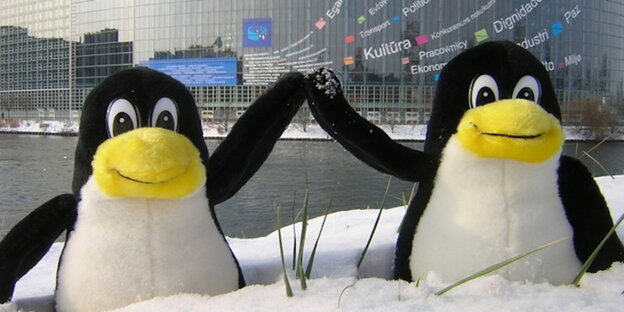
Niedlich-nerdiges Linux-Wappentier Tux, gesehen am Europäischen Parlament in Straßburg. Bild: notfrancois | CC-BY
taz.de: Herr Kirschner, in Berlin ist gerade der 17. LinuxTag zu Ende gegangen. Seit 20 Jahren gibt es Linux und damit auch ein ganzes Betriebssystem, das auf freier Software basiert. Wo ist freie Software heute – ist sie in der Mitte der Gesellschaft angekommen oder weiterhin eher etwas für Computer-Profis?
Matthias Kirschner: Heute hat jedes Unternehmen und jede öffentliche Verwaltung freie Software im Einsatz. Zu Hause setzt auch fast jede AnwenderIn freie Software ein, ob das nun Firefox, Thunderbird, Open Office/Libre Office, Inkscape oder z.B. die Videoabspielsoftware VLC ist. Diese Programme können einfach von jedem installiert und benutzt werden. Allerdings ist freie Software noch nicht vollständig in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Selbst mit fast 30 Jahren ist dieses gesellschaftliche Thema noch zu jung. Dafür müssen noch mehr Menschen verstehen, dass es bei freier Software um wichtige und notwendige Freiheiten geht.
Werden freie Betriebssysteme irgendwann auf dem Heim-PC ankommen? Oder ist diese Vorstellung illusorisch?
Heute ist es schon viel einfacher als noch vor 10 Jahren, freie Betriebssysteme wie Debian, Fedora, OpenSuse oder Ubuntu zu installieren. Allerdings ist die nachträgliche Installation immer noch ein Mehraufwand. Daher wird die Verbreitung stark ansteigen, wenn freie Betriebssystem vorinstalliert auf Heim-PCs gekauft werden können. Wenn wir vom Heim-PC weggehen, ist freie Software, beispielsweise bei DSL-Routern, Videorekordern oder Fernsehapperaten bereits auf Millionen von Geräten von Anfang an installiert.
Google hat gerade mit den "Chromebooks" billige Laptops vorgestellt, die grundlegend auf Linux basieren. Ist das Ihrer Meinung nach ein Erfolg für die Szene?
Nein. Für die Free-Software-Szene ist es wichtig, dass jeder Anwender selbst die Kontrolle über seine Software hat. Mit Computern wie den Chromebooks können Sie nur schwer eigene Software installieren und haben sehr wenig Einfluss darauf, was diese Software macht und was mit den Daten passiert.
Mittlerweile haben sich auch andere Hybriden entwickelt, die geschlossenen Code mit freier Software kombinieren. Googles Android ist das beste Beispiel: Die Grundlagen sind zwar offen, doch wenn es um die wichtigen Google-Anwendungen, weswegen viele Nutzer zugreifen, geht, gehören die dem Konzern allein. Kann "frei" und "geschlossen" parallel existieren?
ist deutscher Koordinator der Free Software Foundation Europe (FSFE), die sich für den Einsatz freier Software stark macht und gegen Monopole auf dem IT-Markt kämpft.
Freie Software und unfreie Software können parallel betrieben werden. Es gibt ja auch viel freie Software, die man auf unfreien Betriebssystemen nutzen kann – beispielsweise Firefox oder das erwähnte VLC, die neben dem freien Linux auch auf geschlossenen Betriebssystemen wie Microsofts Windows oder Apples MacOSX laufen. Auf lange Sicht wird sich jedoch freie Software gegen unfreie Software durchsetzen, davon bin ich überzeugt. Schon weil solche Software die privaten und geschäftlichen Anwender in den Mittelpunkt stellt und deren Position gegenüber den Interessen von Software-Anbietern stärkt.
Die FSFE vertritt in Sachen Open-Source-Lizenzen eher eine "harte" Linie, das heißt, der Freiheitsgedanke soll sich möglichst verbreiten, ein freies Produkt frei bleiben, anstatt dass über andere Lizenzmodelle wieder geschlossener Code entsteht. Kann das in einer kommerziell orientierten Welt funktionieren?
Das kann nicht nur funktionieren – das funktioniert schon. Unabhängig vom gesellschaftlichen Aspekt ist kommerzielle Nutzung bei freier Software immer erlaubt und wir ermutigen Unternehmen explizit dazu, mit freier Software Geld zu verdienen. Des Weiteren garantiert freie Software immer auch Wettbewerb im Softwarebereich und bewahrt Anwender vor den Dienstleistungsmonopolen, die bei unfreier Software zwangsläufig entstehen.
Sie hatten es erwähnt – Linux steckt mittlerweile fast überall, vom Internet-Router über den Fernseher bis zum Haushaltsgerät. Ist das der Beweis dafür, dass solch offenen Systemen die Zukunft gehört?
Ja. Die Freiheit, dass jeder die Software verändern und an die eigenen Bedürfnisse anpassen darf, führt dazu, dass es immer mehr Geräte gibt auf denen freie Software wie GNU/Linux läuft. Wichtig ist jedoch, dass solche Möglichkeiten, die die Gerätehersteller selbst haben, auch beim Anwender ankommen. Manche Hersteller verhindern das mit Hilfe von rechtlichen Einschränkungen oder digitalem Rechtemanagement (DRM), das ich eher als digitale Rechteminderung bezeichnen würde.
Manche Beobachter sagen, die Linux-Verbreitung hätte schlicht damit zu tun, dass es für Gerätehersteller billiger ist, als zu einem kommerziellen Betriebsystem zu greifen.
Ja, die Kosten sind hier auf jeden Fall wichtig. In vielen Märkten, in denen sich freie Betriebssysteme durchsetzen, ist der Preiskampf besonders hart. Bei freier Software fallen keine Lizenzgebühren pro verkauftem Gerät an, daher sind die Kosten besser zu kalkulieren. Die Hersteller haben Fixkosten, um die Software einmal für das Gerät anzupassen. Die Kosten erhöhen sich jedoch nicht, egal ob später 10 Geräte oder 10 Millionen verkauft werden. Daneben sparen Hersteller beim Entwicklungsaufwand. Sie können bereits existierende stabile und gut getestete freie Software miteinander kombinieren, auf die speziellen Anforderungen für das Gerät anpassen und damit kommerziell nutzen. Daher ist es nicht notwendig, Unmengen von Entwicklern damit zu beschäftigen, für jedes Gerät das Rad neu zu erfinden.
Im Bundesaußenministerium ist ein großangelegtes Open-Source-Projekt gerade gescheitert – mit recht merkwürdigen Begründungen. Da wurde unter anderem gesagt, die Pflege sei schwer, es komme zu Inkompatibilitäten.
Die Begründungen zeigen entweder große Unkenntnis über freie Software oder es wurden fadenscheinige Argumente gegen den Einsatz gesucht. Die Probleme im Auswärtigen Amt haben nichts mit freier Software zu tun. Die Fehler resultieren aus einem mangelhaften IT-Projektmanagement. Diese hätte es mit jeder Umstellung auf eine andere Software gegeben. Nach der neuen Antwort des Auswärtigen Amtes sieht es auch so aus, als ob die Behörde in den letzen Jahren nur noch Ausreden gesucht hat, statt ernsthaft zu versuchen, die Mitarbeiter in die Umstellung einzubinden und die Probleme zu beheben.
Was bedroht Linux und Co. mehr – die Usurpation durch Google und Co. oder geschlossene Modelle, wie sie beispielsweise Apple verfolgt?
Apple nimmt dem Anwender alle Freiheiten und packt ihn in einen goldenen Käfig. Google benutzt und fördert viel freie Software, gibt jedoch diese Freiheiten oft nicht an den Anwender weiter.
Die große Herausforderung ist, dass auch Menschen, die sich nicht für Computer interessieren, mit den politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aspekten freier Software auseinandersetzen. Es geht hier darum, dass wir Freiheiten, die wir in unserer Gesellschaft für selbstverständlich erachten, weiterhin ausüben können. Und auch Unternehmer müssen erkennen, dass sie mit dem Einsatz freier Software ein Stück unternehmerische Freiheit zurückerlangen können. Wenn dieses Bewusstsein in der Gesellschaft vorhanden ist und Anwender die Freiheiten aktiv einfordern, werden sich letztlich selbst große Unternehmen wie Apple oder Google dem beugen müssen.




Leser*innenkommentare
hesekiel
Gast
Ich habe eine Zeit lang Ubuntu auf zwei Rechnern zu hause eingesetzt. Probleme Traten dann auf, wenn ich über einen anderen WinXP Rechner drucken wollte. Auch Ordnerfreigaben funktionierten nicht so einfach wie unter zwei WinXP Systemen. Die verschiedenen Zustände (Standby, Ruhezustand) funktionierten auch nicht immer. Selbst das einfache Herunterfahren klemmte sehr oft, da musste die Konsole her. Dennoch habe ich mich gewundert warum das nicht auf etwas älteren Rechnern mit Intel (P4HT) und Intel Chipsätzen nicht ordentlich funktionierte. Heute habe ich wieder beide Rechner unter WinXP laufen.. und es funktioniert wirklich alles. Durch meine politische Einstellung würde ich lieber freie Software einsetzen.. aber ich hatte wie gesagt zu viele Probleme, die ich als Erfahrener Windows-Mausschubser unter Linux nicht in den Griff bekommmen habe. Ich werde Linux dennoch weiter beobachten.
Grüße
hesekiel
rolfmueller
Gast
Politisch engagiere ich mich für freie Software, in der Praxis arbeite ich aber mit Mac OS, weil ich mich mit meinem Computer nicht befassen will. Ich habe noch nie ein Mac OS-Handbuch gelesen. Wenn Open Source-Betriebssysteme auch so intuitiv zu bedienen wären, würde ich sofort umsteigen.
Volker
Gast
Auf meinem Netbook habe ich Ubuntu als zweit-Installation draufgepackt und benutze es inzwischen nur noch (Win7 liegt nur noch so drauf). Aktualisierungen und viele Anwendungen lassen sich ohne Probleme installieren. Dazu läuft es sehr rund. Also ich bin zufrieden.
Nur auf meinem großen PC ist noch Windows drauf, was aber daran liegt, dass die Spielehersteller keine Linux-Versionen ihrer Spiele liefern.
Böhme
Gast
Das Grundproblem von Linux ist die Linux-Gemeinde, ihre Nutzer. Unter den Nutzern gibt es eine Vielzahl von Leuten, die sich mit Linux den Hauch des Exklusiven verschaffen wollen, die zu einer kleinen Gemeinde der Eingeweihten gehören und deswegen überhaupt keine Verbreitung des Betriebssystems wollen. Unter den Programmschreibern sind zu viele dabei, die von dem, was mit dem Programm passieren soll, überhaupt keine Ahnung haben - und deswegen am Zweck und vor allem am Nutzer vorbeiplanen. Ich nutze Linux (Suse/OpenSuSE) seit 1998, soweit man damals von "nutzen" sprechen konnte und kann daher mit dem System umgehen. Weil ich mich irgendwann eingearbeitet haben (mit viel Lehrgeld), beherrsche ich Linux inzwischen besser als Windows - und arbeite zu über 80 % daran. Aber die Bereitschaft, sich auf etwas Neues einzulassen, muss da sein. Und der fehlt den Meisten, die auf dem Rechner Windows mit diverse Standardprogrammen vorinstalliert geliefert bekommen und den Computer nur als Mittel zum Zweck ansehen.
ein tux
Gast
Ok, ich bin als Informatiker sicher nicht der Durchschnitts-User, aber heutige Distros (allen voran sicher Suse oder die Ubuntus) sind schon sehr geschmeidig in der Bedienung. Wenn ich da an meinen ersten Kontakt in den 1990ern denke (Red Hat), es hat sich gewaltig was getan. Vor vier Jahren bin ich dann komplett umgestiegen (XP tuckelt noch in einer virtuellen Maschine, Elster sei Dank...), und ich vermisse exakt _nichts_. Kein nerviges "Windows muss neu gestartet werden" nach Update, keine groben Sicherheitsschnitzer wie immer als Admin unterwegs zu sein, und es ist auch schon länger nicht mehr nötig, Programme selbst zu compilieren (ok, von Exoten abgesehen). Die Software, die 99% der "normalen" PC-Anwendungen erschlägt, gibt es auch für Linux (Office, Mail, Browser, Bildbearbeitung, Musik und Video). Und ja, wenn es klemmt, dann ist die Konsole angesagt, bei Windows hat man keine Chance, bei "schwerer Ausnahmefehler" kommt man oft nicht um eine Neuinstallation herum (als Otto Normal). MacOS ist sicher auch nicht übel (hat ja gleiche Wurzeln wie Linux), aber warum für Standard-Hardware 50% mehr zahlen?
Hauke Laging
Gast
Schlecht formuliert:
"Bei Endanwendern sind geschlossene Systeme wie Windows und MacOSX weiter beliebter als Linux-Systeme"
Dass das so ist, hat herzlich wenig damit zu tun, dass Windows und MacOS CSS sind. Die Leute nutzen Windows, weil sie es kennen und weil es das kann, was sie wollen (und sie das, was Windows nicht kann, nicht oder nur wenig vermissen). Und natürlich, weil sie das andere nicht kennen, bei Problemen mit Windows mehr Leute fragen können und generell einfach voraussetzen können, dass sich jeder Anbieter von Software und Onlienangeboten auf ihre technische Umgebung einstellt. Gerade, wenn man keine Ahnung hat, fühlt es sich eben gut an, einer großen Gruppe anzugehören.
Aber das wichtigste Pfund Microsofts strauchelt: Durch die zunehmende Masse mobiler Geräte kann man eben nicht mehr von einer homogenen "Auf allen Rechnern laufen IE und Outlook"-Landschaft ausgehen. Durch diesen gewaltigen Markttrend wird die Selbstverständlichkeit zerstört, von der MS lebt. Linux wird sich langsam vorarbeiten. Und wenn der Punkt erreicht ist, an dem Anbieter Linux nicht mehr ignorieren können, an dem alles auch unter Linux gut laufen muss, dann geht der Rest ganz schnell. :-)
durchfluss
Gast
Alles schön und gut - ein Ubuntu Linux kriegt auch jeder installiert, aber sobald Probleme auftauchen wirds bei Linux haarig. In den Foren wird quasi eine elitäre Geheimsprache gesprochen man muss in irgendwelchen Eingabefenstern überaus kryptische Zeichenfolgen eingeben und fühlt sich zurückversetzt in die Computer-Steinzeit. Mich wundert es nicht, dass der "goldene Käfig" von Apple attraktiver ist - der Durchschnittsuser will seinen Computer benutzen und nicht konfigurieren usw.
Andreas
Gast
Ein wesentlicher Grund dafür, warum Linux nach wie vor so selten auf dem PC von Endanwendern landet, liegt wohl auch in der Inkompatibilität der einzelnen Distros (Linux-Versionen) untereinander.
Ein Programm per Zeilenkommando zu installieren oder gar aus dem Quellcode zu kompilieren ist den meißten Anwendern schlicht zu kompliziert.
Zwar bieten die meißten Distos mittlerweile einen Paketmanager zum einfachen installieren von Anwendungen an, aber es fühlt sich nicht besonders komfortabel an, sich das für die eigene Linux-Variante richtige Paket raussuchen zu müssen. Hier für allgemiene Standarts zu sorgen wäre ein Schritt in die richtige Richtung.
Werner
Gast
Zitat: "Apple nimmt dem Anwender alle Freiheiten und packt ihn in einen goldenen Käfig."
Fühle mich überhaupt nicht unfrei. Ganz im Gegenteil. Ich kann endlich (nach 20 Jahren wo ich dachte das müßte so sein..) meine Arbeit ungestört von unkomfortablen Benutzeroberlächen, kryptischen Fehlermeldungen, blue screens, lahmen, immer wieder upzudatenden Virenscannern, komplizierten Installationsvorgängen, fehlenden Treibern und dröhnenden Ventilatoren erledigen.
Gold ist halt etwas teuerer als schwarzes Plastik. Das ist es mir wert.
FreiWieInFreibier
Gast
Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Kostenpunkt ist der, dass die meisten Anwender bei ihren Windows- oder Apple-Systemen überhaupt nicht wissen, dass sie Geld für die Software und das Betriebssystem bezahlen.
Die Standardantwort ist normalerweise "Ach, das war bei meinem PC kostenlos mit dabei ...".
Ein Traum - aber leider unrealistisch - wäre es, wenn jeder Computerhersteller die Kosten für das Betriebssystem und die vorinstallierte Software auszeichnen müsste.
Oliver
Gast
"Auf lange Sicht wird sich jedoch freie Software gegen unfreie Software durchsetzen, davon bin ich überzeugt."
Ja, seit Mitte der 90er ist jedes Jahr das "Jahr des Linux-Desktops". Getan hat sich seitdem wenig. Letztlich bleibt es bei der alten Formel: Verwendet wird, was bekannt ist. Verwendet wird, was nicht nervt und womit man am produktivsten sein kann. Wenn das irgendeine freie Anwendungssoftware - toll, andernfalls: Egal.
Bedauerlich ist eigentlich nur, dass so viel freie Software in Qualität, Funktionalität und Benutzeroberfläche mit geschlossener Software nicht mithalten kann (gerade am Mac).