CDU-Affäre um Antisemitismusprojekte: „Das ist hoch kriminell, was da passiert“
Der Vorsitzende der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus kritisiert die Mittelvergabe des Senats. Etablierte Vereine blieben auf der Strecke.
Während Millionen Euro an Fördergeldern gegen Antisemitismus offenbar irregulär vergeben wurden, sind langjährige Projekte von mangelnder Finanzierung betroffen. Die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (Kiga) ist eine davon. Die taz im Gespräch mit Dervis Hizarci, dem Vorsitzenden des Vereins.
taz: Herr Hizarci, ihr Verein macht Workshops an Schulen, Fortbildungen für Lehrkräfte und fördert Dialogformate zwischen Muslim:innen und Jüd:innen. Wie sieht es mit der Finanzierung aus?
Dervis Hizarci: Wir sind auf jeden Fall von Kürzungen betroffen, zwei Kolleginnen mussten wir bereits ziehen lassen. Aber das wird leider nicht ausreichen. Wir müssen diesen Monat in kleinere Büroräume umziehen, weil wir uns die Raummiete nicht mehr leisten konnten. Ab Januar werden wir das Angebot an Schulen in einem deutlich geringerem Umfang anbieten können. Die sogenannte Praxisstelle wurde eingestampft. Das liegt daran, dass uns die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie komplett die Förderung gestrichen hat. Obwohl wir eine zentrale Anlaufstelle für Antisemitismus sind, die sich über Jahre etabliert, Strukturen aufgebaut und Netzwerke ausgebaut hat. Momentan werden wir auf Landesebene nur noch von der Sozialverwaltung unterstützt.
taz: Im Rahmen der 10 Millionen Euro-Förderung für Projekte gegen Antisemitismus wurde ein Sondertopf über 3,4 Millionen Euro für Projekte mit besonderer Bedeutung eingerichtet. Wussten Sie von diesen Fördermöglichkeiten und hat sich Ihr Verein darauf beworben?
Der Mensch: Derviş Hızarcı, geboren 1983, wuchs im Neuköllner Richardkiez als Sohn türkischer Einwanderer mit einem älteren Brüder und einer älteren Schwester auf. Nach dem Abitur am Albrecht-Dürer-Gymnasium in Neukölln studierte er Politik und Geschichte auf Lehramt und unterrichtete zunächst an der Carl-von-Ossietzky-Oberschule in Berlin, später in Willkommensklassen. Aktuell ist Hızarcı für seine Arbeit bei der KIgA als Lehrer freigestellt. Hızarcı hat zwei Kinder. In seiner Freizeit spielt er Fußball im jüdischen Fußballverein Makkabi Berlin.
Der Job: Hızarcı ist seit 2015 Vorsitzender der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus KIgA. Die vor 15 Jahren gegründete Initiative engagiert sich in der politischen Bildung vor allem mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen gegen Antisemitismus und andere Arten von Diskriminierung und Rassismus und bietet dafür etwa Workshops oder Projekttage in Schulen, Lehrerfortbildungen und Beratungen zur Antisemitismusprävention an. Hızarcı ist außerdem Mitglied des 2017 gegründeten Arbeitskreises gegen Antisemitismus des Berliner Senats. (akw)
Hizarci: Ja, wir haben uns immer beworben, seitdem diese Töpfe existieren, beziehungsweise seitdem klar ist, dass es dort Gelder zur Bekämpfung von Antisemitismus gibt. Insgesamt haben wir uns sogar dreimal beworben – eine Förderung haben wir aber nie erhalten. Das erste, was für uns fragwürdig war, dass auf einmal die Kulturverwaltung mit dieser Aufgabe betraut wurde. Als dann auch noch mit Joe Chiallo ein ganz neuer, unerfahrener Senator das Haus führen sollte, war klar, das wird nie gut funktionieren.
taz: Es wurden Gelder an Projekte vergeben, die nicht vollständig geprüft wurden und gegen die es massive Widerstände aus der Verwaltung gab. Wie bewerten Sie das?
Hizarci: Das ist skandalös – in mehrfacher Hinsicht. Es ist nicht zu akzeptieren, dass das Thema Antisemitismus für solche Geschichten instrumentalisiert wird. Und zwar bewusst. Manche in der CDU erhoffen sich da offenkundig einen Freifahrtschein, weil das Thema so unberührbar erscheint. Zum anderen ist es skandalös, weil wir es mit einem rasant steigenden Antisemitismus zu tun haben. Das belegen inzwischen alle Zahlen, gleich ob von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) oder staatlich erfasste Zahlen wie von der Polizei. Auch die Rückmeldungen von den jüdischen Communities sind, dass sie sich Sorgen machen und nicht sicher fühlen. Wir brauchen also jeden Euro im Kampf gegen Antisemitismus. Alle Projekte sind kurzfristig. Wir brauchen Gelder die in nachhaltige Strukturen fließen. Aber stattdessen werden tausende Euros einfach verschenkt: und zwar nicht an Projekte oder Organisationen, die deutlich machen, dass sie die Zielgruppen erreichen, die man erreichen muss. Die von der CDU begünstigten sind keine Organisationen, von denen man weiß, bei ihnen gibt es eine wissenschaftliche Gründlichkeit. Es gibt keine jahrelange Expertise, die sich durchgesetzt hat. Also das Geld wird, das muss man so klar sagen, verpulvert.
taz: Einige der geförderten Projekte, unter anderem eine Immobilienfirma, haben zumindest nicht offensichtlich etwas mit Antisemitismus zu tun. Sind Ihnen die geförderten Projekte bekannt?
Hizarci: Von einigen habe ich etwas gehört, von anderen nicht. Eine Immobilienfirma, die ganz offensichtlich nichts mit dem Kampf gegen Antisemitismus zu tun hat: Noch verrückter geht es gar nicht. Das ist hochkriminell, was da passiert sein soll. Die Zivilgesellschaft und die Organisationen, die wirklich in dem Bereich arbeiten, sind die Leidtragenden von so einem – man möchte fast sagen – korrupten System. Das Augenmerk muss hier bei den politischen Verantwortlichen liegen, ob im Parlament, den Fraktionen oder in den Behörden, ob noch aktiv im Amt oder schon ausgeschieden. Sie müssen überprüft werden und sich verantworten – und zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn sich das bewahrheiten sollte, dass das alles so passiert ist, wie es im Moment aussieht, müssen sie bestraft werden. Als jemand, der auch schon mal in einer Verwaltung gearbeitet hat, weiß ich: Es gibt Vorgaben, es gibt Zuwendungsrecht, es gibt transparente, demokratische, rechtsstaatliche Standards, die man einhalten muss. Das wurde außer Acht gelassen. Und damit ist das natürlich auch ein riesiger Schaden für die Demokratie entstanden.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






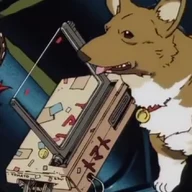
meistkommentiert