Organspende-Stiftungsvorstand tritt zurück: Vier Dienstwagen in sechs Jahren
Thomas Beck, Vorstand der Stiftung Organtransplantation, legt nach Kritik an Vetternwirtschaft sein Amt nieder. Ein weiterer Mitarbeiter duldete illegale Praktiken.
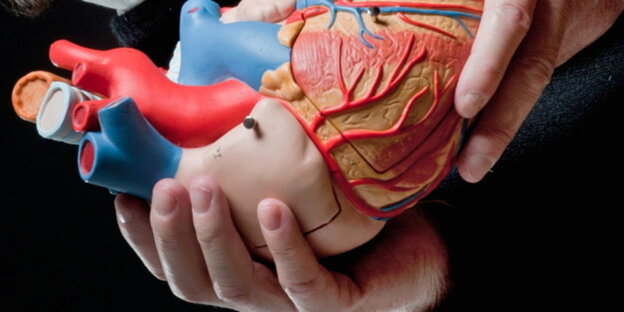
Die DSO koordiniert alle Transplantationen in Deutschland. Bild: dpa
BERLIN taz | Vier Dienstwagen in sechs Jahren. Ein Mont-Blanc-Füller für 323,14 Euro. Vetternwirtschaft. Nicht genehmigte Möbelkäufe im Wert von einer halben Million Euro. Ein Flug zum Fotoshooting in die USA.
Die Vorwürfe gegen die Vorstände der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO), Krankenkassengeld verschwendet zu haben, haben Konsequenzen: Am Freitagabend trat der Kaufmännische Vorstand Thomas Beck zurück. „Der Stiftungsrat der DSO hat der Bitte von Dr. Thomas Beck entsprochen, seinen Vertrag vorzeitig aufzulösen“, teilte die DSO mit. Beck habe seine Entscheidung „mit anhaltenden Attacken auf seine Person“ begründet. Auch wolle er vermeiden, dass das Ansehen der Organspende „durch die anhaltende Diskussion“ Schaden nehme. Ein Wirtschaftsprüfungsgutachten im Auftrag des Stiftungsrats – er ist das DSO-Aufsichtsgremium – hatte unlängst die meisten der zuvor in anonymen E-Mails erhobenen Vorwürfe in der Sache bestätigt.
Der Vorsitzende des DSO-Stiftungsrats, Wolf Otto Bechstein, sagte am Wochenende der taz: „Die Suche nach einer für die Nachfolge geeigneten Persönlichkeit braucht Zeit.“ Er halte es trotz der Debatte über mangelnde Transparenz und Führungsqualitäten in der DSO für „angemessen“, dass die privatrechtliche Stiftung mit Sitz in Frankfurt weiterhin eine der sensibelsten bioethischen Aufgaben verantwortet: Der DSO obliegt die Koordinierung und Durchführung sämtlicher Organspenden bundesweit. Finanziert wird sie von den gesetzlichen Krankenkassen mit jährlich 44 Millionen Euro.
Den Rücktritt des ebenfalls umstrittenen Medizinischen Vorstands der DSO, Günter Kirste, schloss Bechstein aus. Dafür sehe er „keinen Anlass“. Innerhalb der DSO steigt unterdessen der Druck auf Kirste, seinen Posten ebenfalls zu räumen.
Illegale „Crossover-Lebendspende“
Die Kritik richtet sich vor allem gegen Kirstes mangelndes Unrechtsbewusstsein und Verstöße gegen Grundsätze der Medizinethik. So brüstet sich Kirste gern damit, in der Schweiz eine „Crossover-Lebendspende“ zwischen nicht miteinander Verwandten durchgeführt zu haben, für die er sich in Deutschland strafbar gemacht hätte.
Der taz liegen überdies Dokumente vor, die belegen, dass Kirste bis März 2012 illegale Organentnahme-Praktiken der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) wissentlich duldete. Die MHH hatte über Jahre mehrere Chirurgen aus Osteuropa beschäftigt, denen die Approbation in Deutschland bislang fehlte und deren Arbeitserlaubnis sich auf die MHH beschränkte.
Tatsächlich aber sendete die MHH, deren Ärztlicher Direktor Kirstes Mentor Axel Haverich ist, diese Chirurgen zu Organentnahmen in Transplantationszentren in ganz Deutschland aus. Als Medizinischer Vorstand der DSO wäre es Kirstes Aufgabe gewesen, gegen die gesetzeswidrigen Handlungen einzuschreiten, zumal ihn Kollegen darauf hingewiesen hatten. Stattdessen gestand er der MHH eine mehrmonatige „Übergangszeit“ zu und sorgte dafür, dass die Chirurgen von der DSO bezahlt wurden.
Akteneinsicht oder dem Hirntod?
In der Debatte über die Neuregelung des Transplantationsgesetzes forderte Kirste im März in einem Schreiben an die gesundheitspolitischen Sprecher der fünf Bundestagsfraktionen, das der taz vorliegt, ein medizinethisches Kernstück der Reform über Bord zu werfen. Dabei geht es um die heikle Frage, zu welchem Zeitpunkt die Ärzte Einsicht nehmen dürfen in die Erklärung ihres Patienten zur Organspende: Erst nachdem der Hirntod abschließend festgestellt wurde? So will es der Gesetzentwurf. Jeder Eindruck einer interessengeleiteten Therapie soll so vermieden werden. Oder bereits sehr viel früher, dann nämlich, wenn sich der drohende Hirnausfall bloß abzeichnet? Das will Kirste.
Dann nämlich, schrieb er an die Abgeordneten, sei es in bestimmten Fällen möglich, Patienten auch dann künstlich zu beatmen und sie so zu potenziellen Organspendern zu machen, wenn sie eine künstliche Beatmung in ihrer Patientenverfügung ausgeschlossen hätten. Kirste wörtlich: „Der Patientenwille kann nicht abschließend und rechtzeitig ermittelt werden, wenn auf bestimmte Informationen erst nach Feststellung des Hirntodes zugegriffen werden kann.“ Im Klartext: Kirste findet offenbar, dass ein Organspendeausweis im Zweifel die Patientenverfügung schlägt. Bislang galt diese Frage als nicht verhandelbar.





Leser*innenkommentare
naseweis
Gast
Heim schicken, den Kirsten, aber sofort !!!
Das ist genau der falsche Mann an dieser sensiblen Stelle. Niemand will und braucht einen Kommerzgesteuerten an der Organspende-Nahtstelle. Der Mann lässt ja schimmste Befürchtungen, böse Träume und Filmtriller wahr werden. Genau Leute wie er sorgen mit Ihrem Fehlverhalten und Ihrer falschen Einstellung dafür, daß seit Jahr und Tag die Bereitschaft zur Organspende vor sich hin dümpelt.
Weg mit ihm, der nächste bitte !!!
Hopfenschauer
Gast
Die Print-Überschrift war besser: "Organspender spendet Rücktritt" - kürzer, prägnanter, witziger und direkt auf den Punkt gebracht.