Kulturpolitik in Zeiten knapper Kassen: Aufwerten und verdrängen
Berliner vertrieben kürzlich das BMW-Guggenheim-Lab aus Kreuzberg. Dennoch halten viele Unternehmen den Imagegewinn durch private Kulturförderung für lukrativ.

Das Grundstück in Berlin, auf dem das „BMW Guggenheim Lab“ hätte gebaut werden sollen. Bild: dpa
Anfang April gab die Solomon R. Guggenheim Foundation bekannt, das „BMW Guggenheim Lab“ eröffne am 15. Juni im Prenzlauer Berg. Den Standort Kreuzberg hatte das mobile Laboratorium zur Zukunft des städtischen Lebens wegen Protesten aufgegeben.
„Chaoten“, „Autonome“, „Linksextremisten“ hätten das „Lab“ vertrieben, hieß es daraufhin in den Medien. Dabei spiegelt die Aufregung ein allgemeines Unbehagen gegenüber der zunehmenden Infiltration von Kultur durch Firmenlogos und privates Kapital.
In Kreuzberg kam die angespannte soziale Lage hinzu: In keinem anderen Berliner Bezirk liegen Durchschnittseinkommen und -miethöhe so weit auseinander, Aufwertung und Verdrängung sind alltägliche Themen. Dass das „BMW Guggenheim Lab“ „Ideen für die Großstadt“ entwickeln will – so heißt es im Untertitel –, provozierte da. Genauso wie die Selbstverständlichkeit, mit der der Partner und Financier BMW den eigenen Firmennamen platzierte.
Immer mehr Unternehmen setzten auf Kultursponsoring statt auf klassische Produktwerbung. Vor allem die großen Banken und Versicherungen investieren in Museen, Galerien, Opernhäuser und Festivals. Die Deutsche Bank zum Beispiel sponsert die Berliner Philharmoniker, ist Besitzerin einer großen Sammlung zeitgenössischer Kunst, die sie Museen überlässt, und betreibt noch bis Ende des Jahres die Kunsthalle Deutsche Guggenheim in ihrer Hauptresidenz.
BMW ist Partner der Berlinale. Die Deutsche Oper wird von der Audi AG und der Berliner Bank unterstützt. Rund eine halbe Milliarde Euro für Kultur kommt in Deutschland jährlich aus privater Hand. Was aber bringt Unternehmen dazu, in Kultur zu investieren?
Seit Jahren zieht sich der Staat immer mehr aus der Kulturförderung zurück. Bundesweit sind nicht nur randständige Projekte bedroht, sondern auch etablierte Häuser. Zur Aufrechterhaltung des kulturellen Angebots ist immer mehr privates Geld notwendig. Andererseits kämpft die staatliche Förderung in einer differenzierten Gesellschaft um Legitimität. So leistet sich Berlin, das sich selbst als Kultur- und Kreativmetropole bezeichnet, noch immer viel. Mit insgesamt rund einer Milliarde Euro im Jahr werden Opern- und Theaterhäuser, Museen, Musik, Literatur, Kunst und die Freie Szene unterstützt. Trotzdem reicht vielerorts das Geld nicht mehr.
Wer soll gefördert werden?
Zuletzt hatten vier Autoren mit dem Buch „Kulturinfarkt. Von allem zu viel und überall das Gleiche“ eine Abrechnung mit dem Status quo vorgelegt. Ihre These: Die Hälfte der Kulturinstitutionen sei verzichtbar, das frei gewordene Geld solle an die verbleibenden Institutionen gehen. Tatsächlich stellt sich die Frage, wer künftig gefördert werden soll: Ausverkaufte Traditionshäuser oder experimentierfreudige Off-off-Bühnen mit schlechter Auslastung? Zugleich ist die Freie Szene nicht mehr umsonst zu haben – KünstlerInnen können sich das Leben und Arbeiten in den Innenstädten kaum mehr leisten.
Nun haben Unternehmen das brach liegende kulturelle Kapital entdeckt. Den Raum, den die schwindenden Subventionen hinterlassen, beanspruchen zunehmend Stiftungen, Mäzene und Sponsoren. Anders als für den Staat spielt es für sie keine Rolle, ob sich Kultur finanziell rechnet. Als Hauptgrund für Engagement geben sie nach einer Studie des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft im BDI die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung an.
Ebenso zählen ein positives Image und die größere Attraktivität für MitarbeiterInnen. Über 65 kulturfördernde Unternehmen sind im Arbeitskreis Kultursponsoring, einer Initiative des Kulturkreises, vernetzt. Seit der Gründung 1996 hat sich einiges getan. „Das Sponsoring als Mittel der Kulturförderung hat sich etabliert“, sagt Friederike von Reden, Referentin für Kultursponsoring und Kulturpolitik im Kulturkreis.
Zunehmend werben auch die Kulturträger um Unternehmen. Oft notgedrungen. „Unternehmen können allerdings nicht alles auffangen, was die öffentliche Hand nicht mehr leistet“, sagt von Reden. Um den Ruf des Sponsorings zu verbessern, werden Preise ausgelobt. 2011 etwa ging der unter anderem vom Kulturkreis ausgeschriebene Deutsche Kulturförderpreis für unternehmerische Kulturförderung an die „Vattenfall Literaturtage“. Ein umstrittenes Format.
KritikerInnen unterstellten Vattenfall, seinen ramponierten Ruf als Atomstromriese aufpolieren zu wollen. „Das kulturelle Engagement eines Unternehmens zu kritisieren, ist meines Erachtens keine sinnvolle Art, um Kritik am Kerngeschäft zu äußern“, sagt von Reden. Für Unternehmen sei es nicht einfach, Geld abseits von Kerngeschäft und Produktwerbung locker zu machen. Veranstaltungen mit offensivem Branding wie etwa die „Audi Sommerkonzerte“ sind da eine Möglichkeit, den Wert der Kulturförderung zu steigern – anders als im Sport, wo Namensrechte gekauft werden (von „Team Telekom“ bis zur „SchücoArena“), sind die Unternehmen im Kulturbereich meist auch die (Co-)Veranstalter.
Allerdings haben Unternehmen anders als der Staat keinen politischen Auftrag und darum weder bildungspolitische Anliegen noch ein Interesse an einer „Kultur für alle“. Kultursponsoring ist für sie eine Marketingstrategie. „Das hat etwas mit Zielgruppen zu tun, mit dem Image“, sagt Klaus Siebenhaar, Professor am Institut für Kultur- und Medienmanagement der FU Berlin. „Kultursponsoring ist für Unternehmen ein strategisches Instrument.“ Corporate Social Responsibility heißt das Schlüsselkonzept: KäuferInnen sollen die Unternehmen nicht mehr als bloße Produktanbieter wahrnehmen, sondern als engagierte Bürger.
Sponsoring als Investition
Beim „BMW Guggenheim Lab gehe“ gehe es „um eine Botschaft, welche die Leser des Feuilletons besser erreicht als die des Automobilteils“, konkretisierte der BMW-Marketingchef Uwe Ellinghaus im Manager Magazin. Die „Experimental branding-Strategie“ (Ellinghaus) lässt den monetären Gewinn hinter dem Imagezuwachs zurückstehen. Schließlich ist der Autokonzern – in Europa auf dem absteigenden Ast – immer mehr auf jene angewiesen, die seinem Produkt ambivalent gegenüberstehen.
Namen und Logos werden darum in Kontexten platziert, in denen Produktwerbung bisher tabu war. Ohne Konflikte geht das nicht vonstatten: Das „BMW Guggenheim Lab“ hatte sich bei der Standortwahl schlicht verkalkuliert; anderswo behindert das offensive Branding die Wahrnehmung von Kultur als hochwertig – wie beim „Telekom Orchester“.
Kultur als ein Gut, das allen zugänglich sein soll, gilt gemeinhin als interessenfrei. Marketing ist darum für viele ein Reizthema. So eskalierte die Situation in Kreuzberg – schließlich hatte niemand etwas gegen das Konzept des „Lab“. Im Gegenteil: Bis vor Kurzem wäre die Guggenheim Foundation selbst, eine Institution nach einem Franchising-Modell wie McDonald‘s, angegriffen worden. „Der thematische Zusammenhang ist das Problem, denn niemand hat gegen BMW auf der Berlinale demonstriert“, erklärt Klaus Siebenhaar. Er hält das offensive Branding für kontraproduktiv. Mit einem zurückhaltenderen Konzept hätte sich BMW viel Ärger erspart.
Dabei sind das „BMW Guggenheim Lab“ und die „Vattenfall Literaturtage“ nur Leuchttürme der Sponsoringaktivitäten – anderswo taucht das Firmenlogo der GeldgeberInnen lediglich im Programmheft auf. Auch stecken Unternehmen den Hauptteil ihres Geldes in kleine regionale Projekte, deren Unterstützung als selbstverständlich gilt. Die Dresdner Bank etwa unterstützte die Dresdner Museen; in Gütersloh hat der dort ansässige Bertelsmann-Konzern den Theaterneubau und die Stadtbibliothek mitfinanziert. „Man sollte es entspannter nehmen, schließlich bewegen wir uns alle auf dem Markt“, so Klaus Siebenhaar.
Die Kulturförderung steht an einem Scheideweg. Tatsächlich hätte der Staat Möglichkeiten, Geld in die knappen Kulturetats zu spülen – etwa durch eine Reichensteuer, wie sie Frankreichs Präsident François Hollande vor der Wahl versprach. Kultur wird in Deutschland aber schon lange nicht mehr um der Kultur willen gefördert.
Gerade die staatlich geförderten Kulturbetriebe werden penibel evaluiert. Was zählt, sind wirtschaftliche Kriterien: die Auslastung, das eingespielte Geld. Wirtschaftsunternehmen hingegen interessiert etwas anderes. Für sie ist das Sponsoring eine Investition in die Zukunft. Das „BMW Guggenheim Lab“ muss sich nicht rechnen, so lange die Öffentlichkeit vom Spender erfährt.





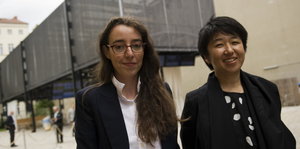
Leser*innenkommentare
auch das noch
Gast
guter artikel, sollte halt doch öfter auch mal unter künste nachschauen . . . war ganz verblendet von bmw, aber es geht ja um kunst.
ThomasR
Gast
Am Schluss des lesenswerten Artikels verwendet die Autorin einen etwas arg verengten Begriff der Evaluation. Diese bedeutet eben gerade nicht, ein Projekt nur auf quantitativ feststellbare Auslastungs- und Wirtschaftszahlen hin zu überprüfen. Das leistet die Kostenrechnung bzw. das Controlling. Evaluationen beinhalten gerade auch die Überprüfung qualitativer Kriterien, wie die Wirksamkeit der Intervention, die Qualität des künstlerischen Angebots und unterm Strich auch die Auswirkungen auf Gesellschaft und Kultur.
Und ich bin froh, dass Kulturinstitutionen nicht mehr planlos vor sich hinwirtschaften dürfen, nur weil sie tolle Kultur machen.