Lukrez über sexuellen Genuss: Materialismus gegen Todesangst
Man darf den römischen Dichter Lukrez als einen radikalen Humanisten im Sinne des frühen Karl Marx lesen. Er verordnet Sinnenfreude.
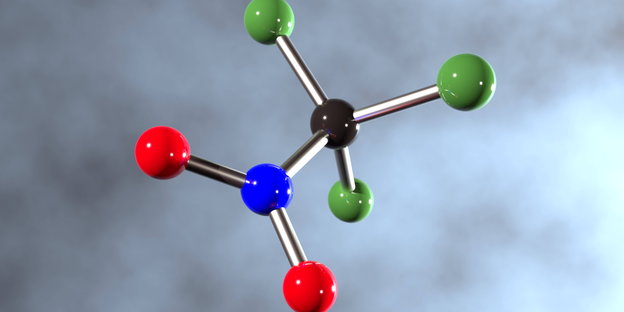
Das zufällige Spiel der Atome hat die Menschen in eine Welt geworfen, die ihnen nicht gewogen ist. Bild: Imago/Science Photo Library
Der Galiani Verlag hat ein Buch veröffentlicht, das sich nicht nur als besonders schönes, teures Geschenk eignet, sondern zudem seinen erlesenen Inhalt in seiner materiellen Gestalt zum Ausdruck bringt – Philosophie für die Gutverdienenden.
In edelstes Leinen gebunden, auf hochwertigem Papier in klarem Satz gedruckt, liegt ein Hand- und Augenschmeichler sondergleichen vor: des römischen Autors Lukrez – er lebte im ersten Jahrhundert vor der christlichen Zeitrechnung – im Original in Hexameterversen gehaltene philosophische Studie „Über die Natur der Dinge“. Bisher war dieser Text lediglich in einer in Versen gehaltenen, eher unansehnlichen zweisprachigen Ausgabe zu erhalten.
Der Übersetzer Klaus Binder, dem es gelungen ist, die lateinischen Verse in eine bestens lesbare, frei schwingende Prosa zu übertragen, widmet die deutsche Neuausgabe seinem philosophischen Lehrer Alfred Schmidt, einem Schüler Max Horkheimers, der mit einer Arbeit über den Begriff der Natur bei Marx bekannt wurde. Er ließ Binder, wie er in der Widmung schreibt, begreifen, „dass Materialismus Leben heißt und offene Sinne“.
Tatsächlich war Lukrez, der Autor dieses jahrhundertelang verschollenen, erst in der Renaissance wiederentdeckten Textes, das, was die Geschichte der Philosophie als einen „Materialisten“ bezeichnen würde.
Begehren und Wollust
Genauer: Lukrez war ein Anhänger des hellenistischen Philosophen Epikur und versuchte in seinem Werk „Über die Natur der Dinge – De rerum natura“ darzulegen, dass die ganze Welt letztlich aus unteilbaren kleinen Partikeln, aus Atomen besteht, dass also auch Seele und Geist nichts anderes sind, als hochkomplexe Zusammensetzungen dieser Elemente und sie daher kein eigenes, unabhängiges Leben jenseits der Körper, in die sie eingelassen sind, haben. Dann aber – und das ist der therapeutische Grundgedanke dieser Philosophie – ist die Furcht vor dem Tode ebenso wie vor den Göttern, ist die Hoffnung auf ein jenseitiges Leben oder die blutige, grausame Praxis des Tier- und Menschenopfers schlicht sinnlos.
Man kann sich daher den römischen Naturphilosophen Titus Lucretius Carus, der von anderen römischen Autoren sowie von einem Kirchenvater erwähnt wird, sehr gut als einen „medicus“, als einen Arzt vorstellen, der einen sorgfältigen Blick mit dem unbedingten Willen verbindet, anderen Menschen die Angst zu nehmen und ihnen auch sonst helfend beizustehen.
Daher ist es ihm ein Anliegen, seinem Publikum sexuellen Genuss geradezu zu verschreiben. Freilich hat die von ihm verordnete Sinnenfreude nichts oder nur wenig mit der Sinnlichkeit erotischer, romantischer Liebe zu tun – im Gegenteil: In seinen Empfehlungen zur körperlichen Liebe erweist sich dieser Philosoph der von ihm sonst bekämpften stoischen Lehre näher, als er wahrhaben will; geht es ihm doch vor allem darum, seine LeserInnen vor leidenschaftlicher Liebe zu warnen.
„Begehren und Wollust ist Venus für uns; von daher der Liebe Namen; von daher tropft uns Venus zuerst süßen Tau ins Herz, und darauf folgend abkühlend Kummer und Sorgen.“ Entsprechend empfiehlt Lukrez, die Liebe zu meiden und „die drängenden Säfte in einen beliebigen Leib zu schleudern, statt sie für die Eine zu bewahren …“
Keineswegs heteronormativ

Allmählich zeigt sich, wie brüchig der Pariser Anschlag Frankreich gemacht hat. „Die Muslime werden dafür teuer bezahlen“, sagt Bestseller-Autor Taher Ben Jelloun in der Titelgeschichte der taz.am wochenende vom 17./18. Januar 2015 Und: „Charlie Hebdo“ spottet weiter: ein weinender Mohammed auf der Titelseite, im Heft Scherze über Dschihadisten. Die Streitfrage „Muss man über Religionen Witze machen?“ Außerdem: Keine Angst vor Hegel. „Viele denken, sie müssten das sorgfältig durchstudieren, wie über eine lange Treppe aufsteigen. Ich finde, man kann auch mittendrin irgendetwas lesen.“ Ein Gespräch mit Ulrich Raulff, dem Leiter des deutschen Literaturarchivs in Marbach. Am Kiosk,
Zu dieser Übersetzung sei angemerkt, dass der lateinische Text keineswegs heteronormativ argumentiert – das Geschlecht der Leiber, in die „drängenden Säfte geschleudert“ werden sollen, bleibt im lateinischen Text unbestimmt. Umso mehr nimmt Lukrez Sorgen um das Zeugen und Empfangen von Kindern ernst und empfiehlt präzise, wie ein entsprechender Geschlechtsakt zu vollziehen sei – habe es doch gar keinen Zweck, „wenn sich die Frau lüstern bewegt; vielmehr hindert es die Empfängnis, wenn sie in ihrer Lust den Akt des Mannes mit schwingendem Hintern, mit weich wogenden Brüsten erwidert. Damit wirft sie den Pflug nur aus der Furche …“
Tatsächlich ging es diesem materialistischen Menschenfreund um Kinder und ihr Wohlergehen; nur sehr wenige Autoren einer Epoche, in der missgebildete Kinder straffrei umgebracht werden durften, haben sich so einfühlsam zum Schicksal Neugeborener geäußert: „Denke auch an Kinder: Wie ein von tosenden Wellen an den Strand geworfener Seemann, so liegt der Säugling am Boden, nackt und ohne Worte, jeder Hilfe bedürftig. Kaum hat ihn die Natur unter Wehen aus dem Leib der Mutter ans Licht des Tages gestoßen, da füllt er mit kläglichem Wimmern den Raum – wie auch anders, hält ihm das Leben doch viele Leiden bereit.“
Mit dieser düsteren Feststellung ist die Frage nach der Eignung der Natur für die Menschen sowie danach gestellt, ob Lukrez am Ende ein Vorläufer der Darwin’schen Evolutionstheorie ist. Klaus Binder wird in seinen – im Originaltext nicht vorfindlichen – Zwischenüberschriften nicht müde, darauf hinzuweisen, dass Lukrez gegen eine teleologische Naturbetrachtung im Geiste des Aristoteles anschreibt: Das zufällige Spiel der Atome hat die Gattung der Menschen in eine Welt geworfen, die ihnen nicht gewogen ist.
Warum dann aber die Tiere dieser Welt besser angepasst sind als die Menschen, kann auch Lukrez nicht erklären. Wer das zufällige Spiel der Atome für das letzte Erklärungsprinzip von allem hält, wird natürlich jedem Gedanken einer Schöpfung aus dem Nichts entschieden widersprechen. Dazu musste Lukrez das Judentum seiner Zeit nicht kennen, Platons Dialog „Timaios“ drückt keinen anderen Gedanken aus.
Menschen, Tiere, Pflanzen
Damit steht schließlich in Frage, ob Lukrez – wie er in der Renaissance, etwa von Giordano Bruno, gelesen wurde – ein Atheist war. Das war er nicht – jedenfalls nicht im heutigen Sinne dieses Begriffs. Für Lukrez gehörten Götter ebenso zur Welt wie Sterne, Pflanzen, Tiere und Menschen. Sie sind seiner Überzeugung nach Wesen, die selig, unsterblich, von Leid und Mitleid unberührt, in ihren eigenen Sphären existieren. Als solche aber haben sie keinen Grund, sich die Zuneigung und Anbetung der Menschen zu wünschen: „Welchen Vorteil könnten sie, die doch selig sind und unsterblich, aus unserer Gunst ziehen.“
Wenn aber die Menschen den Göttern gleichgültig sind, können auch den Menschen die Göttern egal sein. Für der Menschen Wohl und Wehe können und müssen alleine die Menschen einstehen. Man darf Lukrez daher als einen radikalen Humanisten im Sinne des frühen Karl Marx lesen. Verfasste dieser doch 1841 eine Dissertation zum Thema der Differenz zwischen demokritischer und epikureischer Naturphilosophie.
Indes: Auch der sinnenfrohe Materialist Lukrez kommt ohne letzten Sinnbezug, ohne Appell an das Göttliche nicht aus. In seinem Fall zeigt sich das bei der Anrufung der Göttin Venus, mit der er sein Lehrgedicht eröffnet: „Mutter […] der Menschen und der Götter Wonne, Venus, Spenderin des Lebens […]. Dir verdankt alles Belebte Empfängnis, den ersten Blick auf der Sonne Licht …“
Es ist die Göttin Venus, die Lukrez anruft, beim Schreiben des Lehrgedichts seine Gefährtin zu sein – ein Wunsch, ein Begehren, das er später für sinnlos erklären wird, leben doch die Götter, auch deren höchste, in selbstgenügsamer Abgeschiedenheit. Wohlwollende Leser werden diesen Widerspruch für unerheblich und die ersten Zeilen des Gedichts für eine Floskel halten – aber warum?
Drängt sich doch der Eindruck auf, dass Lukrez seinen Atheismus nicht wirklich durchhält, er vielmehr zunächst einen Schöpfungsglauben propagiert, an dem er jedoch angesichts des Elends der Welt sowie des ausbleibenden Eingreifens der Götter verzweifelt. Juden- und Christentum versuchen bis heute, diesen Widerspruch auszuhalten.




Leser*innenkommentare
Lowandorder
Mit schmunzelndem Vergnügen gelesen;
warten wir also im Sinne von Kurt Tucholsky
auf die Taschenbuchausgabe.