Pflege von Demenzkranken: Wenn sich nur der Gärtner kümmert
Demenzkranke sind akut von der Abschiebung in stationäre Heime bedroht. Das Verschwinden von Frau P. zeigt, wie frustrierend die Situation vieler Alter ist.

Altersverwirrte Menschen brauchen helfende Hände. Anspruch darauf haben sie nicht. Bild: dapd
In einer kleinen Straße im Berliner Norden lebt Frau P. in einem großen Haus. Ihr Mann hat es einst für sie und sich gebaut, und für die Kinder, die die P.s dann nie hatten. Vor 25 Jahren ist er gestorben, seither ist Frau P., inzwischen 87 Jahre alt, allein.
Und jetzt? Eine Nichte, 700 Kilometer entfernt. Ein Verwandter in Übersee. Und Frau P.: heiser, weil ihre Gelegenheiten für Gespräche selten geworden sind. Ängstlich, weil ihr die Beine nicht mehr gehorchen wollen. Und stark verunsichert, weil sie oft nicht weiß, ob sie aus der Haustür kommend rechts oder links abbiegen muss, um zu ihrem Hausarzt zu kommen.
Es gibt Grund, sich Sorgen zu machen um Frau P.
Neulich, nachts: Zwei Feuerwehren, ein Polizeiauto. Der Verwandte aus Übersee hatte Alarm geschlagen, er könne Frau P. nicht erreichen. Eine Recherche in den umliegenden Kliniken ergibt: Schon Mitte August ist P. nach Behandlung eines Oberschenkelhalsbruchs entlassen worden. Wohin? Für die Folgebehandlung in Pflegeeinrichtungen sei es nicht zuständig, bescheidet das Krankenhaus, man möge verstehen: Krankenhausaufenthalte zahle die Krankenkasse, anschließende Pflege die Pflegekasse. Kommunikation zwischen beiden: nicht existent.
Uniformierte brechen die Tür auf
20 Uniformierte umstellen daraufhin P.s Haus. Brechen die Tür auf. Und finden drinnen: keine Frau P. Dafür einen Zettel mit der Handynummer von Ralf K., 59, ihrem Gärtner. Dem Einzigen, der sich kümmert. Jetzt soll er, es ist nachts um zwei, sagen: was er mit der Frau gemacht hat! Sie untergebracht, vorübergehend und in einer Rehaklinik, dummerweise ohne Vollmacht. Aber was, fragt er, hätte er denn tun sollen? Ansonsten wäre Frau P. in einem Pflegeheim gelandet - gegen ihren Willen.
Ralf K. hat das gemeistert, womit ein Heer Ehrenamtlicher im Einsatz für die bundesweit etwa 1,5 Millionen daheim Gepflegten gemeinhin alleingelassen wird: Er hat sich durchgekämpft durch einen Dschungel aus Paragrafen, die regeln, welcher Sozialversicherungsträger, welcher Pflegedienst, welcher Arzt und vor allem: welche Kostenstelle ihm helfen könnten. Damit er wiederum sein Versprechen einlösen kann: dass Frau P. in ihrer gewohnten Umgebung alt werden darf. "Für die ambulante Betreuung einer Dementen aber gibt es praktisch kein Geld", klagt K., "wenn das so weitergeht, muss Frau P. doch ins Heim."
Das ist das Dilemma, vor dem die schwarz-gelbe Koalition steht, wenn sie in dieser Woche über die Reform der Pflegeversicherung berät: Mehr als zwei Drittel der Deutschen wünschen sich laut Umfragen, in den eigenen vier Wänden zu altern. Und sie haben laut UN-Behindertenkonvention einen Anspruch darauf, erinnert der Geriater Christoph Fuchs vom Städtischen Klinikum München: "Demenz ist eine Daseinsform. Wir brauchen nicht weitere Medikation, sondern mehr menschliche Präsenz."
Pflegereform seit einem Jahr angekündigt
Allein: Die Politik ist dieser Frage bislang ausgewichen. Und das, obwohl der Handlungsbedarf messbar ist: Die Zahl der Pflegebedürftigen von derzeit 2,4 Millionen wird sich in einer demografiebedingt und dank des medizinischen Fortschritts stetig alternden Gesellschaft bis zum Jahr 2050 ungefähr verdoppeln; die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Dritte dieser Menschen dement wird, ist hoch.
Bei der seit einem Jahr angekündigten Pflegereform, deren Eckpunkte Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) am 23. September vorlegen will, muss es folglich um mehr gehen als nur um zusätzliches Geld. "Es geht um einen Paradigmenwechsel", sagt der Sozialexperte Jürgen Gohde (parteilos), der bereits unter der großen Koalition ab 2007 den Pflegebeirat leitete und neuerdings auch den Bundesgesundheitsminister berät.
Es fehle nicht nur an Unterstützung für Angehörige, an altersgerechten Wohnungen - bundesweit 2,5 Millionen - und Nachbarschaften, in denen auch Demente möglichst lange selbstständig leben könnten, weil es dort Lebensmittelläden, Ärzte oder Friseure in für sie erreichbarer Nähe gibt. Es fehle vor allem die gesetzliche Anerkennung dessen, dass auch geistige Gebrechen einen Anspruch auf Leistungen aus der Pflegeversicherung begründen.
Versicherung greift nicht bei Demenz
Die derzeitige Pflegeversicherung, von Arbeitgebern und Arbeitnehmern paritätisch finanziert (Beitragssatz: 1,95 Prozent vom Bruttolohn, Kinderlose: 2,2 Prozent), ist nur eine Teilkaskoversicherung. Sie greift zudem derzeit nur bei körperlichen Gebrechen, nicht aber bei psychisch-kognitiven Beeinträchtigungen, also bei Demenz. Ihre Reserven reichen noch zwei bis drei Jahre; anschließend muss der Beitragssatz erhöht werden, auch ohne Erweiterung des Leistungskatalogs.
Nach Berechnungen des Gesundheitsministeriums dürfte der Beitragssatz bei unveränderter Leistung bis 2050 auf 2,7 Prozent klettern; der ehemalige Wirtschaftsweise Bert Rürup geht von "etwas mehr als 3 Prozent" aus. Das ist, gemessen an der jährlichen Kostenexplosion bei der gesetzlichen Krankenversicherung, nicht viel Geld. Würde allerdings die Demenz mitberücksichtigt, könnte das jährlich bis zu 4 Milliarden Euro mehr kosten, in Beitragssätze umgerechnet: 0,3 bis 0,4 zusätzliche Prozent.
Das Tempo, in dem die Koalition um Inhalte wie Finanzierungsmodelle (siehe Text unten) ringt, lässt nicht unbedingt darauf schließen, dass Frau P. in einer kleinen Straße im Berliner Norden in Würde ihr Leben wird beschließen können.


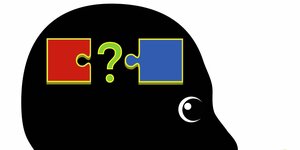
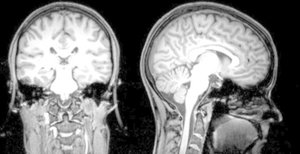

Leser*innenkommentare
Wedding
Gast
Als Angestellte einer großen Sozialstation in Berlin-Wedding,tätig in einer Wohngemeinschaft für Menschen die an Demenz erkrankt sind, erlebe ich täglich die Situation der Betroffenen, Die Wohnungen sind zu klein und in einem schlechten Zustand, es gibt keine Pflegebäder, nach Anweisung der Geschäftsführung darf ein Bewohner nur geduscht werden, wenn er bereit ist den Lifter zu benutzen (die Ängste vieler Kranker vor diesen Geräten muss ich nicht extra bescheiben).Um als Angestellte keine angedrohte Abmahnung zu erhalten bleibt also nur die Körperpflege per Waschlappen übrig! Die vielgepriesene Bezugspflege ist ein Hohn: wie sollen wir auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohner eingehen können, wie sollen wir Krisenintervention leisten,wenn der Dienstplan nach maximaler Gewinn-
orientierung gestaltet wird? 10 Bewohnenr=1 Betreuer!
Eine weitere Variante der Gewinnmaximierung
Bulgarische Krankenschwestern wurden im Januar 2012 als Arbeitnehmerinnen in die Sozialstation geholt. Ihnen wurde "ein schönes Zimmer mit Blumen und Konfekt" als Unterkunft versprochen. Polizeilich gemeldet sind sie in der Wohnung der Chefin der Sozialstation, sie wohnen aber in nicht belegten Zimmern der Dementen-WG mit einer garantiert g e s t ö r t e n Nachtruhe. Es gibt keine Mietverträge, ihnen wurde eine kostenlose Unterkunft zugesagt. Tat-sächlich entstehen aber Kosten für Raummiete, Energiebedarf usw.! Die Vermutung liegt nahe, dass diese Kosten nicht vom Profit des Betreibers abgehen,sondern vom Konto der Betreuten. Nach dem ersten Arbeitsmonat wurde keine Lohnabrechnung ausgehändigt mit dem Hinweis darauf, dass diese immer im Büro bleiben müsse!
Aus den nur kurz geschilderten Umständen ergeben sich für mich notwendige Forderungen:
1. die Heimaufsicht muss auch tätig werden im WG-Bereich,
2. die per Amtsgericht bestellten Betreuer müßten sich einer regelmäßigen Kontrolle beugen und nachweisen, dass sie sich regelmätig vor Ort des Wohlergehens ihrer Schutzbefohlenen versichern.
Nur so können Mitarbeiter, frei von Abmahnungen und anderen Drohungen seitens der Arbeitgeber, Standards
in Wohngemeinschaften für Demente einfordern und realisieren.
Ein Wedding voller Hoffnung
BerlinaWoman
Gast
"ABSCHIEBUNG in stationäre Heime". Da hat jemand keine Ahnung, über welche Krankheit sie schreibt.
Womue
Gast
"Demenz ist eine Daseinsform..." - da muß man auch erst mal drauf kommen, gratuliere! Vielleicht ist es ja demnächst noch eine Lebensart? Abgesehen von der Hoffnung auf medizinische Erfolge sollte man vielleicht einmal die herrschende Doktrin ein wenig überarbeiten. Denn dass so viele sich auch in schlimmsten Zustand und im hohen Alter nicht entschließen können, selber Schluß zu machen mit der eigenen Qual, das liegt am Bild vom Freitod in der öffentlichen Meinung. Und es sind keineswegs nur verlogene christliche Moralapostel, die das Versagen, die Ehrlosigkeit und die Feigheit daran gehängt haben. Man sollte auch nicht aus dem Blick verlieren, dass Ärzte und Pflegeindustrie sich an diesen Patienten dumm und dämlich verdienen. Das ist ein Musterbeispiel für doppelte Moral in diesem Land.
Pfleger
Gast
Jene, welche die Windeln wechseln, können sich
keine Aktienpakete leisten.
Florentine
Gast
"Versicherung greift nicht bei Demenz". Wiedereinmal ein typischer taz-Artikel. 1(!) Satz entlarvt die Nicht-Qualität des Artikels und die Recherchebemühungen und Genauigkeit der Autorin/des Autors (Schämen sie sich da nicht mittlerweile,taz?)
In der Pflegeeinstufung gibt es seit einigen Jahren (!) bei Verdacht oder Vorliegen von Demenz extra Kriterien. Zusätzlich zu den Leistungen der Pflegeversicherung gibt es seit einigen Jahren Gelder für die bessere Betreung Demenzkranker. Zuhause und auch im Heim. Auch gibt es einen zusätzlichen Personalschlüssel ausschließlich für die Betreuung Demenzkranker.Aber natürlich geht es immer noch besser und es ist Verbesserungsbedarf.
Selbstverständlich ist die Versorgung/Betreuung Demenzkranker zuhause das möglichst lange aufrechtzuerhaltende Ideal. Wer sich allerdings mit Demenz auskennt, weiß, dass hier auch bei in der Nähe oder sogar im Haushalt lebenden Angehörigen der ambulanten Pflege-Versorgung ab einem bestimmten Zeitpunkt Grenzen gesetzt sind.(Da nützt der Friseur ums Eck genau - nichts). Auch der Leidensfähigkeit der Angehörigen, der Versorgungsqualität bei den Dementen. Hier kommt das viel geschmähte Altenheim ins Spiel. Gerade auch wenn neuere Heime baulich und vom Pflegekonzept auf die Betreuung Demenzkranker ausgerichtet sind, ist die Versorgung ab einem bestimmten Verlaufspunkt der Erkrankung in einem Heim sicherer und besser, menschenwürdiger. Für den Kranken! Achtung: das geht (nicht immer) auch ohne oder mit reduzierter Mediakation (wobei ich die Autorin ggf. sehen möchte, wenn ihr Angehöriger, sorry, zuhause durchdrehen würde, schlägt, spuckt, unter sich lässt, sie beschimpft und nicht mehr erkennt). Dies hat nichts zu tun mit dem Bild vom 'Heim als Verwahranstalt', das medial gerne vermittelt wird. Aufgabe der Politik und deren Medien sollte es sein, die Heime immer besser in die Lage zu versetzen, die Dementenbetreuung, ggf mit Umbaumaßnahmen und gutem -ausgebildetem!- Personal (hier rede ich nicht von der ungelernten sogenannten Pflegerin aus Polen, der Ukraine ...!) die Versorgungslage stets zu verbessern.
Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist die Aufwertung der Pflegetätigkeit (mir ist bewusst, dass die Realität gerade deren Abwertung ist), die mehr ist als das medial gepflegte Bild vom, sorry, Hintern sauber machen. Was sich auch finanziell zeigen muss(Realität:Mindestlohn 8,50 West, 7,50 Ost). Geschult beim Thema Demenz gehörten auch gerade Ärzte. Nur weil jemand Mediziner ist, kennt er nicht das Krankheitsbild und die erforderliche Versorgung .In den Medien muss Schluss gemacht werden mit dem Märchen über Demenz, worin dann erzählt wird, naja, die Oma hat Demenz, sie ist halt 'tüdelig' und das isses. Ne, Demenz geht bis zum absoluten Pflegefall mit allen Erscheinungen, das muss wahrheitsgemäß publiziert werden (dann werden vielleicht auch Artikel darüber realistischer).
Was dazu gehört, ist aber auch eine bessere- d.h. wirklich unabhängige!- Überprüfung der Versorgungsqualität Demenzkranker zuhause und im Heim. Unabhängig von der Interessenslage und Einflussnahme mancher (kommunalen oder privaten) Träger.
dicius
Gast
Obwohl es vielleicht noch dreißig Jahre hin sind bei mir, ich zwei Kinder habe, mache ich mir Gedanken wie ich an entsprechende Kontakte, Medikamente, Apparaturen, verständnisvolles Fachpersonal komme, um mir ein solches Schicksal eigeninitiativ zu ersparen.
ich setze nicht viel auf die Politik und auch nicht auf die Mitmenschen, von denen viel zuviele Kinder ablehnen / abgelehnt haben, ihr Leben als double income no kids geniessen und trotzdem hoffen, dass es genügend Nachwuchs gibt, der in ein paar jahrzehnten die angesparten Aktienpakete kauft, sie durch den Park rollt und ihnen gegen ende die Windeln wechselt und oben wieder Brei einlöffelt.
Armes Deutschland