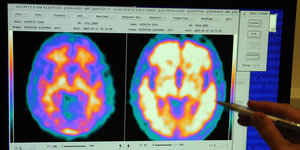Kunstvermittlung für Demenzkranke: Immerzu Unvermutetes
Am Frankfurter Städel startet ein Pilotprojekt für Menschen mit Alzheimer. Dabei werden Betroffene und Angehörige gleichermaßen einbezogen.

Patientinnen in einem Wohnheim für Alzheimerkranke halten sich die Hände. Bild: dpa
Der Arzt Alois Alzheimer beschrieb als Erster die „Krankheit des Vergessens“. An der Frankfurter Anstalt für Irre und Epileptische traf er 1901 seine berühmteste Patientin: Auguste Deter. Sie prägte einen Satz, der Demenz schön in Worte fasst: „Ich habe mich sozusagen selbst verloren.“ Es trifft sich also ausgesprochen gut, dass gerade das Frankfurter Städel Schauplatz des Pilotprojektes „Artemis“ für Demenzkranke wird.
Patienten und Angehörige nehmen an Führungen teil und werden danach auch selbst künstlerisch tätig. Dafür geschulte Kräfte bringen sie ins Gespräch über Kunst, ihre Wirkung, Art und Weisen.
An diesem Morgen steht die Kunstvermittlerin Dagmar Marth vor dem Gemälde „Carmencita“ des Impressionisten Lovis Corinth. Es zeigt seine aufgetakelte Frau Charlotte. „Arrogant“, kommt es sofort von einer Teilnehmerin. „Sie will zeigen, was sie hat“, vermutet ein anderer. Immer wieder beginnen die Frauen und Männer ihre Sätze mit „Ich sehe“ oder „Ich sehe auch“. Satzanfänge, die an Kinderspiele erinnern oder an Beschwörungen der eigenen Imagination. Während eine Frau ganz vorne das Wort führt, sitzt neben ihr ein Mann still in sich versunken und blickt beinahe ängstlich auf das Gemälde.
Gemeinsam mit der Kunstvermittlerin wird es erkundet wie ein unentdeckter Kontinent. Der Hauptunterschied in der Arbeit mit Demenzkranken besteht für Dagmar Marth in der Unberechenbarkeit der Gruppe, immerzu geschieht Unvermutetes: Einer lacht, eine singt, ein anderer bekundet plötzlich, keine Lust mehr zu haben. Ähnlich wie bei kleinen Kindern, wobei man bei denen darauf eingestellt sei.
Gesellschaftliche Teilhabe
Das gemeinsam mit dem Arbeitsbereich Altersmedizin der Goethe-Universität durchgeführte Projekt ist die erste umfassende wissenschaftliche Studie zur interaktiven Kunstvermittlung und dem Potenzial von Kunsttherapie bei Demenz. Die Idee dazu kam vom MoMA in New York, wo es ein ähnliches Projekt mit Demenzkranken gab, wie Johannes Pantel, Leiter des Arbeitsbereichs Altersmedizin, erläutert.
Im Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) fand er sofort einen Verbündeten. Der kennt sich aus, leitete, bevor er Oberbürgermeister wurde, ein Altenhilfezentrum und hat deswegen auch Erfahrung im Umgang mit Demenzkranken und ihren Angehörigen. In der Vergangenheit wurde ihm oft seine mangelnde Kulturbeflissenheit vorgehalten. Für dieses Projekt scheint Feldmann indes der goldrichtige Schirmherr. „Das Alter gehört in die Stadt“, fordert er, und das gerade auch in einer schönen, reichen, jungen Stadt wie Frankfurt. In den In-Bezirken sehe man kaum Gruppen von alten Menschen.
Gesellschaftliche Teilhabe aber habe nun einmal viel mit der Würde im Alter zu tun. Eine Einschätzung, die man an diesem Morgen auch von Teilnehmern der Studie hört. Etwa von dem Ehepaar aus Offenbach, das sich schon sein ganzes Leben lang gerne miteinander Kunstwerke und Kirchen angeschaut hat. „Wir wollen uns nicht verstecken“, sagt die Frau, während ihr demenzkranker Mann immer mal wieder aus heiterem Himmel lacht.
Dann sagt er: „Wir sind schnell gemeinsam begeistert von einem Bild“ und schaut verschwörerisch drein. Die gesellschaftliche Teilhabe ist der Knackpunkt des Vorzeigeprojekts, das sich zur Nachahmung empfiehlt. Von etwa 1,5 Millionen Demenzkranken in Deutschland geht man aus, sagt Pantel, in Frankfurt rechne man mit rund 15 000. Und die Zahlen steigen.
Subjektives Wohlbefinden
Für den Direktor des Städel, Max Hollein, eignet sich sein Museum auch deswegen, weil es 700 Jahre Kunstgeschichte unter einem Dach vereint. Die Studie ist auf zwei Jahre angelegt, insgesamt 120 Menschen sollen vor und nach dem Museumsbesuch zu ihrer Stimmung und ihrem Gedächtnis befragt werden. Alle Verantwortlichen versichern schon jetzt, das von der Familie Schambach-Stiftung geförderte Projekt auch danach fortführen zu wollen.
Während für die Musiktherapie bereits Wirksamkeitsbelege vorliegen, stehen sie für die Kunsttherapie noch aus. Pantel vermutet aber, dass das subjektive Wohlbefinden der Patienten gesteigert, kognitive Prozesse angeregt und die Beziehung zu den Angehörigen stabilisiert würden. In den Ateliers des Städel werden die Teilnehmer dann selbst zu Künstlern. Zu Vorgaben wie Familie, der Farbe Blau oder Collage malen, schöpfen und kleben sie ihre Welt. Die Ergebnisse sind oft überraschend, mal sehr frei, mal ausgeklügelt und spitzfindig, immer aber unberechenbar.