Hintergrund GoogleBooks: Die Schlacht ums Urheberrecht
Der Internetkonzern Google hat Millionen Werke eingescannt, um sie zu vermarkten. Deutsche Autoren und Verlage wehren sich dagegen. Dienstag läuft die Einspruchsfrist beim US-Gericht aus.
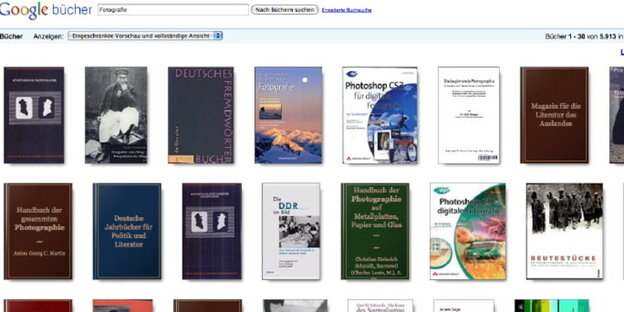
Deutsche Bücher im Volltext lesbar bei Google. Bild: screenshot books.google.de
FREIBURG taz | Google ist nicht nur eine Suchmaschine, sondern inzwischen ein gewaltiger Konzern, der auf vielen Feldern des Internets Geschäfte macht. Eine der aufregendsten Ideen: Google ist dabei, mehr als 15 Millionen Büchern einzuscannen, um sie im Internet verfügbar zu machen. Allerdings hat das US-Unternehmen vorher nicht die Verlage und Autoren gefragt. Deshalb wird jetzt vor Gericht gestritten. Ein Prozess, der über den Zugang zum Wissen der Welt entscheidet. Am Dienstag laufen wichtige Fristen ab.
Eigentlich ist die Vorstellung wunderbar. Wer kurz etwas in einem Buch nachschauen will, muss es nicht aufwändig bestellen und kaufen, sondern kann dies online im Internet erledigen. Um vergriffene Bücher lesen zu können, muss man nicht mehr in die Bibliothek, sondern geht zu books.google.de. Die Idee, Bücher zu digitalisieren, haben zwar auch andere Unternehmen und gemeinnützige Organisationen, aber niemand ist soweit wie Google. Das US-Unternehmen hat seit 2004 in Zusammenarbeit mit überwiegend amerikanischen Bibliotheken bereits mehr als sieben Millionen Bücher eingescannt. Darunter sind auch rund 100.000 deutsch-sprachige Bücher.
Dabei fing Google ganz harmlos an und berief sich auf den "fair use" (angemessenen Gebrauch), der nach nach US-Recht zulässig ist. Man habe nur den Bibliotheken geholfen, ihre Bestände zu digitalisieren, damit Studenten und Wissenschaftler von zu Hause aus Zugriff auf die Bücher der eigenen und befreundeter Büchereien nehmen können. Im Gegenzug wollte Google zunächst lediglich kleine Ausschnitte (snippets) aus den Büchern in der Google-Suchmaschine anzeigen.
US-Autoren und -Verleger hielten aber auch das schon für unzulässig, und klagten gegen Google. Mit einer Sammelklage (class-action) prozessierten sie für alle Verlage und Autoren weltweit. Ein komplizierter Prozess, der Millionen Dollar kostet.
Deshalb haben sich Google und die Kläger zusammengesetzt, um einen Vergleichsvorschlag auszuarbeiten, das so genannte Google-settlement. Dem Vorschlag zufolge würde Google für jedes bisher eingescannte Buch 60 Dollar (41 Euro) Entschädigung zahlen. Insgesamt stellt Google 125 Mio. Dollar für Entschädigungen, Prozesskosten und die Abwicklung des Vergleichs in Aussicht.
Doch das Settlement schaut vor allem nach vorn. Künftig wollen Google, US-Verleger und -Autoren gemeinsam große Einnahmen aus der Vermarktung von Büchern im Internet erzielen. So könne der Kunde sich in Zukunft einzelne Bücher über Google gegen Bezahlung herunterladen oder ein Abo für ganze Bibliotheken erwerben. 63 Prozent der Erlöse, so der Vorschlag, würde an Verlage und Autoren gehen, der Rest bliebe bei Google. Google würde dabei Abschied nehmen von seinem bisherigen Gratis-Image.
Bei lieferbaren Büchern müssten Verlage/Autoren der Google-Vermarktung jeweils zustimmen, bei vergriffenen Werken könnten sie der Google-Nutzung nur widersprechen. Vor allem letzteres ist umstritten, weil hier die Interessen von Autoren, die sich nicht kümmern oder nicht mehr kümmern können, einfach übergangen werden. An solchen "verwaisten" Büchern würde Google allein verdienen.
Wer bei diesem Vergleich nicht mitmachen will, hat noch bis Dienstag, den 8. September, Zeit, sich zu melden. Dann läuft eine bereits mehrfach verlängerte Frist aus. Deutsche Verleger- und Autorenverbände empfehlen diesen Weg nicht. Denn dann verzichtet man auf 60 Dollar pro Buch und müsste allein in den USA gegen Google klagen.
Noch ist aber auch nicht sicher, ob der Vergleich überhaupt zustande kommt. Das zuständige US-Bundesgericht in New York muss nämlich noch prüfen, ob der Vergleich "fair, angemessen und vernünftig" ist. Hierzu wird es am 7. Oktober eine Verhandlung (fairness hearing) geben. Viele mächtige Google-Konkurrenten haben schon Widerspruch erhoben. So fürchtet der Online-Händler Amazon um sein aufkommendes Geschäft mit elektronischen Büchern, wenn sich Google.books mit seinen eingescannten Büchern im Handstreich zum größten Buchhändler der Welt macht.
Widersprochen haben auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Bundesregierung. Sie bemängeln, der Vergleich verstoße gegen internationale Verträge zum Urheberrecht. Danach müsse ein Urheber zwingend vorher gefragt werden, bevor jemand sein Werk nutzt. Justizministerin Brigitte Zypries (SPD) will erreichen, dass der Vergleich nur für US-Bücher, nicht für deutsche Werke gilt. Auch für solche Einwände endet am Dienstag die Frist.
Sollte der Vergleich aber doch weltweit wirksam werden, müssen die deutschen Autoren überlegen, wie sie mit ihm umgehen. Derzeit werden zwei Strategien vertreten. Der Buchhandel schlägt eine harte Linie vor: Alle Autoren und Verlage sollen gemeinsam gegenüber Google auftreten und der Nutzung vergriffener Bücher widersprechen. Dies ist im Rahmen des Vergleichs durchaus möglich, Google müsste dann mit den Verlagen neu verhandeln. Ob dabei materiell bessere Erlöse erzielt werden können als im Settlement vorgesehen, weiß zwar niemand. Aber zumindest wollen die Verlage das Prinzip durchsetzen, dass Google vorher fragen muss und nicht, dass die Verlage bzw. Autoren Google hinterherlaufen müssen. Die Verhandlungen mit Google (und anderen Firmen) soll die in München ansässige VG Wort führen, eine Verwertungsgesellschaft, die im Auftrag von Verlagen und Autoren zum Beispiel Pressespiegel abrechnet.
Fachautoren aus der Wissenschaft haben jetzt allerdings dazu aufgerufen, sich nicht hinter der VG Wort zu scharen, sondern das Google-Settlement sofort zu nutzen. Sonst bestehe die Gefahr, dass wissenschaftliche Werke auf unbestimmte Zeit dem Zugriff der Öffentlichkeit entzogen werden, heißt es in einem Aufruf des Aktionsbündnisses "Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft", dem vor allem Organisationen aus dem Umfeld der Hochschulen angehören. Hintergrund: Wissenschaftler wollen vor allem sichtbar sein und sind weniger darauf angewiesen, mit ihren Veröffentlichungen Geld zu verdienen als zum Beispiel Roman-Autoren. Bis zum 15. September müssen Verlage und Autoren widersprechen, wenn sie nicht wollen, dass die VG Wort für sie verhandelt.
Offiziell betreffen die derzeit laufenden Verhandlungen nur die Online-Nutzung von Büchern auf dem US-Markt. Google sagt, es könne anhand der IP-Adresse des Computers sehen, ob der Nutzer in Amerika oder in Europa sitze. Aufgrund des Vergleichs könnten nur US-Nutzer die eingescannten Bücher in Gänze sehen. Deutsche Nutzer, die nicht tricksen, sehen nur das deutsche Angebot von books.google.de. Bücher, die dort in großen Ausschnitten oder in voller Länge sichtbar sind, stehen dort entweder mit Einverständnis des Verlags oder sind nicht mehr urheberrechtlich geschützt, wie der Faust von Goethe.
Justizministerin Zypries gibt auf die Unterscheidung der Märkte nicht viel. "Das Internet kennt bekanntlich keine Grenze", begründete sie ihr Engagement in einem US-Gerichtsverfahren. Mit einigen Tricks könne man seinen Standort verschleiern und dann doch aus Deutschland auf US-Angebote zugreifen. Außerdem werden die in den USA eingescannten Bücher auch zur Beantwortung von Google-Suchanfragen aus Deutschland genutzt. Insofern habe der aktuelle Streit doch Auswirkungen auf die ganze Welt.
Zyries will vor allem verhindern, dass Google sich mit seinem frechen Vorpreschen einen Vorteil und eine marktbeherrschende Stellung sichert. Für die Ministerin geht es dabei auch ums Prinzip: "Wer nach dem Motto 'erst tun, dann fragen' agiert, darf nicht belohnt werden".


