Das Leben von Ausländern in Russland: Rassismus mit Rückenwind
In Russland häufen sich rassistische Übergriffe auf Ausländer. Daran wird auch die Wahl am Sonntag nichts ändern - im Gegenteil. Ein Besuch in Tomsk.
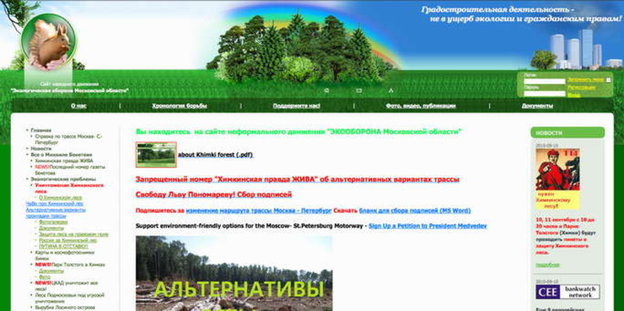
Nicht wirklich willkommen: Menschen mit dunkler Hautfarbe haben es schwer in Russland. Bild: dpa
Mitten in Westsibirien - Achmed Ibrahimas sitzt in Tomsk auf einer Bank vor dem Haus der Völkerfreundschaft, einem Kulturtreffpunkt, und raucht billige Zigaretten. Der Tadschike aus der Nähe von Duschanbe will eigentlich fort. Weg aus dem Land, in dem er sich so willkommen fühlt wie eine Busladung Leprakranker. "Rassisten sind sie fast alle", schimpft er. Aber nie fällt ein Name. Wer "alle" sind, lässt sich nur erahnen.
Das Moskauer Forschungsinstitut Sowa, das sich mit Fremdenfeindlichkeit befasst, zählte im letzten Jahr 541 rassistische Überfälle, bei denen 55 Menschen getötet wurden. Dieses Jahr gab es mehr als 40 rassistisch motivierte Morde. Diese Zahlen spiegeln ein landesweites Problem wieder und gehören zu den Geschichten, die in die Öffentlichkeit dringen. Denn nicht alle Übergriffe finden Beachtung, und nicht alle Betroffenen wenden sich an die Polizei. Insgesamt nimmt die Abneigung gegen Migranten, insbesondere gegen Kaukasier, stetig zu. Umfragen des Instituts für sozialpolitische Forschungen der Russländischen Akademie der Wissenschaften haben herausgefunden, dass bei 57 Prozent der Befragten die Kaukasier allgemein "negative Reaktionen" hervorrufen. CAK
Er ist misstrauisch, denn in Russland hat die Intoleranz gegenüber Fremden ein ungekanntes Ausmaß erreicht. Menschen mit dunkler Haut, dunklen Haaren und dunklen Augen werden in Russland sowieso nicht gerne gesehen.
Neben der alltäglichen Fremdenfeindlichkeit macht aber auch die Politik den Migranten das Leben schwer. Denn seit dem 1. April ist in Russland Ausländern der Markthandel gesetzlich verboten.
Seitdem hat Achmed sehr viel Zeit, denn auch er darf nicht mehr auf dem Zentralmarkt verkaufen, auf dem er sieben Jahre arbeitete. Er ist einer von etwa zwölf Millionen Migranten, die in Russland leben und arbeiten, etwa eine Million tadschikische Männer sind darunter - vor allem als Hilfsarbeiter. Das bedeutet, jeder dritte Tadschike im erwerbsfähigen Alter verdient sein Geld in Russland. Auch Achmed gehört zu den billigen Arbeitskräften aus dem Ausland, die Hochhäuser bauen, Straßen reparieren und bis vor kurzem auf den Märkten schufteten.
Mit dem Verbot, auf den Märkten zu handeln, sollen mehr Arbeitsplätze für Russen geschaffen werden. Gleichzeitig wird aber die Angst vor einer vermeintlichen Überfremdung geschürt. "Rassisten sind sie fast alle", wiederholt Achmed und zieht an seiner Zigarette.
Der 40-Jährige ist groß und hat breite Schultern, seine schwieligen Hände zeugen von einem anstrengenden Leben, und mit seinen braunen Augen schaut er müde. Seit 15 Jahren lebt er in Tomsk. Die ersten acht Jahre arbeitete er auf Baustellen, danach verkaufte er auf dem Zentralmarkt am Lenin-Prospekt. Es war ein schlechter Job, über deutsche Selbstverständlichkeiten wie eine Krankenversicherung oder einen Pensionsanspruch kann er nur lachen. Jeden Tag stand er auf, fuhr mit der Elektritschka zu dem Markt und verkaufte Obst und Gemüse. Schweigsam und ernst stand er neben dem kleinen Holztisch, auf dem die Waren lagen. Es gab bei ihm, wie an jedem Obst- und Gemüsestand, von Gurken bis zu Melonen alles. Er beherrschte die Kunst des ausgewogenen Sortiments auf einem Stück Holz. Nur Freitagmittag nahm und nimmt er sich auch heute noch eine kurze Auszeit und besucht das Gebet in der roten Moschee im tatarischen Viertel. Sein Leben rund um den Markt bezeichnet er als trostlos.
Aber er hatte einen geregelten Alltag, der ihn zeitweise die Sehnsucht zu seiner Familie lindern half. Seine Familie, das sind seine Frau und sein 16-jähriger Sohn. Sein Wunsch ist, dass es sein Sohn besser haben soll. Ohne diesen Antrieb kein Aufstehen am Morgen, kein Durchhalten auf dem Markt, kein Glaube an die Rückkehr. Bis das Gesetz kam, welches Achmed seine Arbeit nahm: "Ich sitze hier in Tomsk und hoffe, dass ich endlich wieder arbeiten kann." Denn seit er nicht mehr auf dem Markt verkaufen darf, kann er kein Geld mehr an seine Familie schicken. Er schlägt sich durch, kann für sich selber sorgen, aber auch in Tomsk werden Fremde nicht gerne eingestellt.
Wer hierhin will, fährt von Moskau aus entweder 52 Stunden und 3.500 Kilometer mit der Transsibirischen Eisenbahn oder wagt einen Flug mit einer klapprigen Maschine, um in der endlosen Weite auszusteigen. Die Landschaft ist atemberaubend, 60 Prozent des Gebietsterritoriums sind bewaldet, der größte Sumpf der Welt befindet sich in Westsibirien. Nur eine Millionen Menschen leben in der Region, jeder dritte Einwohner auf dem Lande. Was Fremde von der Stadt sehen, ist die Lenin-Straße mit ihren schicken Geschäften, die überteuerte Kleidung im Angebot haben. Auf den Straßen ruckeln die Autos über die Schlaglöcher.
Die sonst so verbreiteten Bilder des Präsidenten Wladimir Putin sucht man vergebens in Tomsk. Dagegen hängt im polytechnischen Institut ein Gemälde von Michail Chodorkowski, dem Oligarchen, der wegen angeblicher Steuerhinterziehung im Gefängnis sitzt. Chodorkowski hatte die Universität finanziell unterstützt, deswegen will man sich auch weiterhin an ihn erinnern. Tomsk wird auch das "sibirische Oxford" genannt, denn hier steht die älteste Universität der Region, und die Anwesenheit zahlreicher Studenten lässt in der Stadt das Leben pulsieren.
Wenn in Tomsk geheiratet wird, besuchen die Hochzeitsgesellschaften das gigantische Denkmal zur Erinnerung an den Sieg über Hitlers Armeen. Wer die lachenden Paare vor den Tafeln mit den Namen der Kriegsgefallenen sieht, bekommt plötzlich eine Ahnung davon, wie paradox die Stimmung ist: Gerade das Land, welches einst gegen Hitlerdeutschland kämpfte, hat ein gewaltiges Nationalismusproblem.
Denn nationalistisches Gedankengut ist in der russischen Bevölkerung weit verbreitet. Bei einer Umfrage des Meinungsforschungszentrum Lewada 2006 lehnten nur 28 Prozent die Aussage "Russland den Russen" als faschistisch ab. Mehr als die Hälfte der Befragten sprach sich für die Umsetzung dieser fragwürdigen Losung aus.
Ein Problem, mit dem Achmed jeden Tag konfrontiert wird. "Immer wieder sehe ich verächtliche Mienen", sagt er, lässt grinsend vier Goldzähne aufblitzen und zündet sich eine weitere Zigarette an. Warum er lächelt? "Es hat doch keinen Sinn mehr, sich aufzuregen", antwortet Achmed. Vielleicht kann man nur mit einer gewissen Gleichgültigkeit überleben. Angegriffen wurde er noch nicht, aber dafür umso häufiger beschimpft. "Verschwinde" oder "euch Ausländer muss man alle verjagen" gehören da noch zu den harmloseren Sätzen. Durch Wladimir Putins fragwürdige Marktwirtschaft fühlen sich die Fremdenfeinde dann auch noch staatlich bestärkt.
Auch auf dem Tomsker Zentralmarkt arbeiten keine Migranten mehr. Lediglich vor dem Haupteingang tummeln sich Kaukasier, die erst auf Nachfrage Handys zücken - um sie zu verkaufen. Sie werden nur geduldet, solange sie ihre "Geschäfte" heimlich machen. Spricht man die Gruppe an, reagiert sie zunächst misstrauisch. Die Migranten wissen, dass sie nicht gewollt sind. Es vergeht kaum ein Tag, ohne dass neue rassistische Überfälle gemeldet werden. Im Mai wurde in Moskau ein Rechtsextremer gefasst, der 37 Morde an Kaukasiern gestand. Der 18-Jährige begründete die Morde damit, dass er "die Stadt säubern" wollte. Achmed kann sich nicht erklären, woher diese Wut kommt. "Wir arbeiten doch hier und verhalten uns möglichst unauffällig", sagt er. Er fühlt sich gedemütigt. Gedemütigt durch die Russen, die ihn nicht arbeiten lassen. Gedemütigt durch die Menschen, die ihn ignorieren, weil er ein Fremder ist. Menschen, die durch ihre Hautfarbe als Nichtrussen erkennbar sind, Linke oder Homosexuelle - Menschen, die "anders" sind - werden erstochen, erschlagen, erschossen. Rassistische Überfälle nehmen in Russland seit Jahren zu (siehe Kasten). Wie ist so etwas möglich in einem Lande, das Millionen Opfer im Krieg gegen den Nationalsozialismus und aus der Zeit des Stalinismus zu beklagen hat?
Eine mögliche Antwort darauf gibt Wassili Hanewitsch. "Die Russen haben nichts aus ihrer Geschichte gelernt", sagt Hanewitsch, der Mitglied bei der Menschenrechtsorganisation Memorial in Tomsk ist: "Außerdem braucht unsere Gesellschaft immer einen Sündenbock", so Hanewitsch: "Das sind in der Regel immer die Ausländer." Was dies für die Migranten in Russland bedeutet, will er nicht näher erläutern. Nur das: "In unserer Regierung sitzen keine Demokraten. Diejenigen, die unsere Politik beherrschen, geben dem rechtsextremen Pöbel auf der Straße noch Rückenwind."
Worte, die auch von Anna Politkowskaja hätten sein können. Die ermordete Journalistin schrieb in einem ihrer letzten Artikel: "Würde morgen in Russland eine Revolution ähnlich der in Kirgisien und der Ukraine losbrechen, geschähe dies mit Sicherheit nicht in den Hauptstädten, sondern in der Provinz. An der Spitze der Opposition gegen das Putin-Regime stünden dann aber keine Demokraten, sondern ultrarechte russische Nationalisten."
Auch Achmed fühlt sich als Sündenbock. Er hat Angst, dass der Hass größer wird. Weil er sich mit Gefühlen schwertut, erzählt er einen russischen Witz, der seine Befürchtungen widerspiegelt: "Um das Totenbett eines Tadschiken versammeln sich die Verwandten. Da flüstert ein Greis: 'Schützt die Juden! Ich flehe euch an - schützt die Juden!' Als der Jüngste fragt: 'Warum?', antwortet der Alte: 'Wenn sie mit den Juden fertig sind, nehmen sie sich die Tadschiken vor'."


Leser*innenkommentare
Schneider
Gast
Im Westen auch : der Polizeipräsident von Lyon (Frankreich) hat in einem Schnellverfahren den afrikanischen Adoptivsohn einer alteingesessenen französischen Familie abgeschoben ! Ist er zu schwarz für die Franzose ?
Ayhan
Gast
Ja ne ist Klar :O)
Was ist mit NO GO AREAS in der Bundesrepublik Deutschland ??