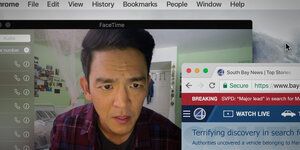Erfahrungsräume in der Kunst: Die Kunst und die Spektakel-Industrie
Die Selbstwahrnehmung steht im Fokus der Ausstellung „Welt ohne Außen“: Man kann sich auf Turnmatten wälzen und grünen Tee schlürfen.

Ein Hauch von Psychodelic: Lucio Fontana in Zusammenarbeit mit Nanda Vigo, Installation „Utopie“ Foto: Lorenzo Palmieri
Fangen wir an mit der gelungensten Arbeit, die in der Ausstellung „Welt ohne Außen“ im Gropius-Bau in Berlin zu sehen ist: die beiden beweglichen Bänke, die der dänische Künstler Jeppe Hein auf der Empore im Lichthof des Gründerzeitbaus aufgestellt hat. Setzt man sich auf das unspektakulär wirkende Sitzmöbel, beginnt es ganz langsam von links nach rechts zu fahren. So thront man wie auf einer Art horizontalem Treppenlift, erfreut sich an graduell sich verändernden Perspektiven und sich verschiebenden Sichtachsen und bemerkt Details der prachtvollen Architektur, die einem vorher nie aufgefallen waren.
Damit erreicht die Arbeit im Grunde das Gegenteil davon, worum es in der Ausstellung eigentlich gehen soll: Statt eine andere Betrachtung von Wirklichkeit zu ermöglichen, geht es bei den gezeigten Installationen und Environments in erster Linie darum, dem Betrachter einen geschlossenen Erfahrungsraum vorzugeben und ihn dadurch mit sich selbst und seiner eigenen Wahrnehmung zu konfrontieren.
Ausgangspunkt sind Arbeiten aus den 60er Jahren, als infolge von Minimal Art einerseits, psychedelischen Be-ins andererseits Wahrnehmungsprozesse in den Mittelpunkt der künstlerischen Produktion traten. Mit einer Glasskulptur von Larry Bell und einer Lichtinstallation von Doug Wheeler sowie einer Rekonstruktion von Lucio Fontanas bordeauxrotem plüschigen Environment „Utopie“ von 1964 wird diese Epoche zügig abgearbeitet – keine Gruppe Zero, kein James Turrell, kein früher Jeffrey Shaw ist zu sehen.
Auch die interaktive Medienkunst der 80er und 90er Jahre, als mithilfe von Computern imaginäre virtuelle Räume entstanden, spielt keine Rolle. Dabei gäbe es hier interessante Anknüpfungspunkte zu der Virtual Reality der Gegenwart, die in den Veranstaltungen und Ausstellungen zum Thema „Immersion“ im Gropius-Bau – zu denen auch diese Präsentation gehört – immer wieder eine Rolle gespielt hat.
Erotische Geselligkeit
Stattdessen begibt sich die Ausstellung zügig in die Gefilde der „relationalen Ästhetik“, wie sie der französische Kunstkritiker Nicolas Bourriaud bei Werken entdeckt hat, bei denen der Betrachter zur Interaktion mit anderen Betrachtern oder dem Künstler verleitet werden soll. Da kann man an einer Teezeremonie der Künstlerinnen Dambi Kim und Isabel Lewis teilnehmen oder sich in einem Workshop unter Anleitung von abermals Isabel Lewis zu elektronischen Klängen auf Turnmatten herumwälzen. Dieser Akt „erotischer Geselligkeit“ soll uns „zu einer Verbindung mit unserer inneren Welt“ führen, „um radikaler empfänglich für äußere Welten zu werden“.
Das klingt ein bisschen nach Yoga-Retreat oder nach der „Orgasmic Meditation“, die die in Verruf geratene US-Firma OneTaste zum Geschäftsmodell gemacht hat.
So weit wie bei diesem Unternehmen geht es in der Ausstellung dann zwar doch nicht, aber hoch intensive, physische Erfahrungen will die Show durchaus bieten: „Immersion ermöglicht neues Wissen durch unmittelbares Erleben: eingehen und eintauchen, Teil sein und in Beziehung stehen“, heißt es in der Beschreibung der Ausstellung, die im selben Atemzug suggeriert, dass dies der kritischen Distanz und dem reflektierten Betrachten vorzuziehen sei.
Grüner Tee und Laptop
Adorniten und andere Miesepeter mögen das als Akt der Weltflucht oder gar als Regression empfinden. Aber selbst wenn man sich auf die Prämisse der Ausstellung einlässt, bleibt die Frage, ob es überhaupt noch „Räume ohne Außen“ gibt, wenn selbst die Künstlerin Dambi Kim in ihrem makellos gestalteten Raum am Laptop hängt, wenn sie nicht gerade nach allen Regeln der koreanischen Kunst grünen Tee aufgießt.
Generell wird die Prämisse der Ausstellung durch den gut durchgetakteten Zeitplan konterkariert, nach dem die BesucherInnen in den Genuss weltentrückter Erfahrungen kommen sollen. Sobald die Vorführung der Duftorgel „Smeller“ von Wolfgang Georgsdorf zu Ende ist, heißt es – „um Punkt 1 Uhr“, wie die Aufsicht betont – sich vor dem Schliemann-Saal einzufinden, um einer der Performances beizuwohnen, die Teil der Ausstellung sind.
Dort wird man in unserem Fall von zwei Assistenten in Bademänteln abermals auf Matten platziert. Und wird dann von dem Künstler Thomas Proksch – beduftet mit ätherischen Ölen – im Dunkeln bei einer Meditation angeleitet, um einen warmen, goldenen Ball durch den Körper wandern zu fühlen. Anschließend verausgabt sich Proksch mit Kunststoffpompons bei einem rituellen Tanz unter Schwarzlicht-Neonröhren, was ein bisschen an einen Goa-Rave der 90er Jahre erinnert.
Es wäre zu leicht, dieses Treiben als Spa-Kunst abzutun. Die Kuratoren Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele, und Tino Sehgal, der als Künstler auch mit einer Arbeit vertreten ist, haben sich hier schon etwas getraut. Je nachdem, wann man die Ausstellung sieht und in welche der täglich wechselnden Performances und Workshops man gerät, mag der Eindruck ganz anders ausfallen – es gibt darum auch Eintrittskarten, mit denen man die Ausstellung immer wieder besuchen kann.
Ringelpiez mit Anfassen
Wohl ohne es angestrebt zu haben, stellt die Ausstellung die Frage, ob es der Kunst guttut, wenn sie die direkte, individuelle Erfahrung über die stille Kontemplation von künstlerischen Vorgaben stellt. Die Environments und Erfahrungsräume, die Künstler seit den 60er Jahren gestaltet haben, waren eben auch Vorläufer des Ringelpiez mit Anfassen, der heute – von als „Erlebniswelt“ gestalteten Einkaufszentren bis zur theatralischen Neueinführung von neuen Produkten, etwa auf Automobilmessen – zum täglich Brot einer eigenen Spektakel-Industrie geworden ist.
Die Environments und Erfahrungsräume, die Künstler seit den 60er Jahren gestaltet haben, waren eben auch Vorläufer des Ringelpiez mit Anfassen
Mitmachen, direkte Erfahrung, ausflippen, Teil von etwas zu sein, das größer als man selbst ist, waren und sind nicht nur Element von totalitären Parteiaufmärschen von Hitler bis Trump, sondern auch von Raves, Holi Festivals und dem Münchner Oktoberfest.
Wer mit Pyronalen, Escape Rooms, Imax-Kinos mit DolbyAtmos-Sound und Augmented-Reality-Simulationen à la Pokémon Go sozialisiert worden ist, ist von den Arbeiten in dieser Ausstellung möglicherweise etwas unterwältigt. Wenn selbst die elaborierte Lichtinstallation von James Turrell in der Kapelle des Dorotheenstädtischen Friedhofs auf diesen Seiten kürzlich als „unspektakulär“ beschrieben wurde (was sie im Vergleich mit einem Konzert von Beyoncé oder einer Nacht im Tresor ja auch möglicherweise ist), sollte man sich fragen, ob die Kunst einem übersättigten, reizüberfluteten Publikum dadurch dient, dass es sich auf diese Überwältigungslogik einlässt.
Vielleicht ist man doch nicht nur ein altmodischer Querulant, wenn man daran erinnert, dass Kunst eben auch Kritik, Systemstörung, Hinterfragen von Prämissen und Unterwandern von Erwartungen sein kann. Oder, in Abwesenheit solcher Konzepte, wenigsten eine superlangsame, doch erkenntnisfördernde Fahrt mit einer Museumsbank durch den Gropius-Bau.