Doku „76 Days“ über Corona in China: Empathie und Zärtlichkeit
Der Dokumentarfilm „76 Days“ zeigt die Arbeit des überlasteten Krankenhauspersonals in Wuhan – und erzeugt eine unaufdringliche Nähe.

Pfleger haben in Wuhan ihre Namen auf den Schutzanzügen notiert, um erkannt zu werden Foto: Dogwoof/MTV Documentary Films
„Zu Hause bleibt eine Familie glücklich“, steht auf dem knallroten Banner an den Absperrungsbaken sinngemäß in chinesischen Lettern. Es ist Februar 2020. Wir sind in Wuhan, kurz nach der offiziellen Anerkennung der Epidemie durch den chinesischen Staat. Dort spielt dieser Film.
Doch die Menschen in ihm haben nicht mehr das (fragwürdige) Glück gemeinsamen Quarantäne-Cocoonings. Sie sind hospitalisiert, wenn auch in unterschiedlichen Funktionen: als Ärztin oder Pfleger, Patientin oder Patient. Oder in der Doppelrolle, wie die Krankenschwester, die in der bewegt bewegenden Eingangszene des Films mit dem körperlichen und moralischen Einsatz ihrer – wie sie selbst – durch Schutzanzüge und Visiere ganzkörperbedeckten Kolleg*innen daran gehindert wird, dem im Sterben liegenden Vater nahe zu kommen. Denn krank werden darf sie nicht.
„76 Days“. Regie: Hao Wu, Weixi Chen, Anonymus. USA/China 2020, 93 Minuten. Läuft auf Dogwoof on demand
Die Szene sieht in ihrer geschlossenen Dramaturgie inszeniert aus, ist aber wohl echt. Ihr folgt in dem Dokumentarfilm „76 Days“ gleich eine weitere tragödiengerecht wuchtige Situation, wenn das Personal eines Krankenhauses mit verzweifelter Kraft versucht, aus den an die Pforte drängelnden Menschenmassen nur einzelne hineinzulassen und sich so die eigene Arbeitsfähigkeit zu sichern.
Dann werden nach und nach einige Patienten in unterschiedlichem gesundheitlichen und mentalen Zustand vorgestellt. Ein junges Paar, das neben der eigenen Coviderkrankung eine Geburt zu bewältigen hat und erst mal voneinander isoliert wird. Eine alte Dame, die sich um den im Nachbarraum liegenden Ehemann sorgt. Ein dementer Fischer und Genosse, der sich mit der Isolation nicht abfinden will und mit viel Mühen (darunter auch der Appell an seine Parteiloyalität) davon abgehalten werden muss, die Klinik zu verlassen.
Nicht der erste Film zum Thema
„76 Days“ (so lange dauerte der Lockdown dort) ist nicht der erste Film zur Situation in Wuhan, neben anderen hatten Ai Weiwei mit dem regimekritischen „Coronation“ und jetzt zum Jahrestag der offiziell vom Staat unterstützte „Days and Nights in Wuhan“ von Cao Jinling auf sich aufmerksam gemacht. In „76 Days“ kommt Politik nur in ihren Reflexionen in den staatlichen Maßnahmen oder dem eingangs erwähnten Slogan vor.
Doch wie Weiwei hat auch Hao Wu seine Produktion aus dem westlichen Ausland in Kooperation mit Co-Regisseuren vor Ort realisiert, die in Wuhan in vier Krankenhäusern und (für kurze Zwischenstücke) auf der Straße drehten. Zum Neujahrsfest war der in China geborene Regisseur selbst noch bei seinen Eltern in Schanghai gewesen, hatte sich dann aber kurz vor der Einstellung des Flugverkehrs für die Rückkehr nach New York entschieden und von dort die Montage übernommen.
Um möglichen Repressalien zu entgehen, bleibt einer dieser Co-Regisseure auch im Abspann anonym. Die Verantwortlichen in den Kliniken selbst standen nach einem Statement Wus den Dreharbeiten aber meist positiv gegenüber, auch weil sie sich von der Öffentlichkeit mehr Aufmerksamkeit für die verzweifelte Situation auf den Stationen erhofften.
Da wird viel gerannt und geschrien, auch weil die schwere Montur die Kommunikation behindert, immer wieder hängen Pfleger erschöpft auf den Wartestühlen im Korridor. Zur Identifikation untereinander haben sie sich ihre Namen auf die weißen Overalls geschrieben, kritzeln aber auch Smileys und Blümchen daneben, um sich die Überanstrengung zu versüßen.
So viel Zärtlichkeit
Auch sonst ist auffällig, dass bei allem Stress Empathie und Zärtlichkeit im Umgang mit den Patientinnen und Patienten dominierten, die offiziell nur mit Nummern bezeichnet sind, vom Personal aber familiär „Auntie“ oder „Grandpa“ genannt werden. Diese bedanken sich überschwänglich für die Sorge, zu der neben Händchenhalten auch der Handy-Kontakt mit den Angehörigen gehört. „Lecker!“, sagt ein zahnloser alter Mann, als eine Pflegerin ihm in warmes Wasser getunkte Brötchenstücke verfüttert.
Die Kamera stellt Nähe her und passt sich den jeweiligen Situationen unaufdringlich fluide an, kommentierende Akzente wie das Motiv eines im Raum hängenden gläsernen Glückssymbols sind unaufdringlich einmontiert. Die Erzählung kommt nur aus den Situationen selbst, nie aus übergestülpten Mitteln wie Musik oder Kommentar.
Ein einzigartiger, für die Produktion sicherlich kniffliger Aspekt dieses Fly-on-the-Wall-Films ist dabei der durch die Situation erzwungene Verzicht auf Mimik und Gesichter: Während die Kranken hinter ihren OP-Masken wenigstens noch an der Augenpartie erkannt werden können, ist das medizinische Personal – zumindest für ein westliches Publikum – gar nicht zu identifizieren.
Interessanterweise wirkt diese äußere Entindividualisierung als emotionaler Verstärker für die Mühen und Anstrengungen des Kollektivs. So wirkt – ein Jahr nach Beginn der Pandemie – Hao Wus Film nicht als Rechtfertigung chinesischer Politik, zeigt aber im Chorgesang aus der Krisensituation die Stärken nicht-individualistischer Tugenden wie Pflichtgefühl und Solidarität.
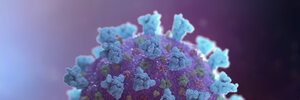

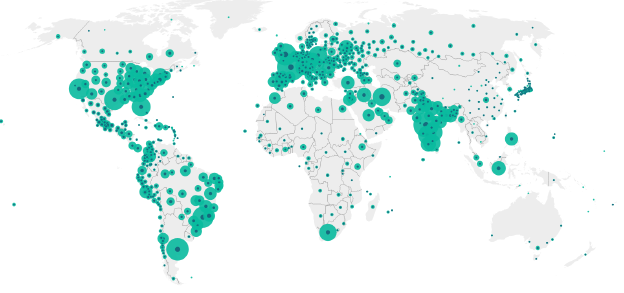






Leser*innenkommentare
Ostwind
Ich kann aus den Berichten meiner chinesischen und deutschen Freunde und Bekannten bestätigen, dass die chinesische Gesellschaft insgesamt solidarisch, empathisch sowie gelassen und optimistisch gegen die Pandemie gekämpft hat. So nahmen sehr schnell zehntausende Ärzte, Pfleger und Freiwillige aus ganz China ihre Arbeit in Wuhan auf, die Bilder der provisorischen Krankenhäuser, die innerhalb weniger Tage errichtet wurden, gingen um die Welt, sorgten im Westen für Staunen, aber leider nicht zur Einsicht, dass man sich auf eine ähnlich schlimme Situation im Rest der Welt vorbereiten muss. Der solidarische Einsatz der Chinesen ermöglichte es, dass inmitten der Pandemie die Arbeitszeit für Pfleger und Ärzte von acht auf sechs Stunden pro Tag verkürzt werden konnte, was dazu führte, dass sowohl beim Personal als auch bei den Patienten die Zahl der Infizierten signifikant zurückging. Ich wünsche deutschen Ärzten und Pflegern, die gegen das Corona in den Krankenhäusern kämpfen eine ebenso positive Maßnahme. Man darf ja mal träumen!