Das Filmfeuilleton der „FR“: Als das Sehen noch lehrbar war
Kritische Theorie und Kino. Kracauer und Adorno. Das waren die Referenzpunkte einer legendären Zeit der Filmkritik in der „FR“ in den 70er, 80er Jahren.
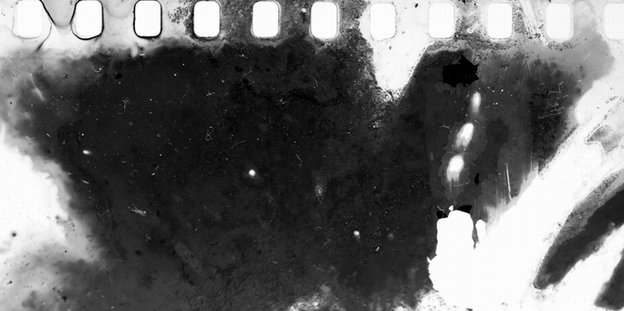
Was die Filmkritiker Schütte, Koch und Witte in der „Frankfurter Rundschau“ betrieben, war insofern besonders, als es ein Labor war. Bild: michaket/photocase.com
In der Geschichte der Frankfurter Rundschau gibt es etwas, was einem Stern gleicht. Obwohl es schon lange verglüht ist, leuchtet es und wird auch noch dann leuchten, wenn die Zeitung im Museum des Jahres 2013 verschwunden sein wird. Die Rede ist von der besonderen Gestalt, die die Filmkritik der Rundschau in den 70er und 80er Jahren annahm.
Untrennbar verbunden ist sie mit drei Autoren, mit Wolfram Schütte, Gertrud Koch und Karsten Witte. Die drei versuchten sich an etwas, was heute nurmehr als Ausnahme vom journalistischen Alltag geduldet wird. Sie vermischten akademisch-theoretische und feuilletonistische Schreibweisen.
Filmgeschichte, Theorie und Kritik bildeten für sie einen Zusammenhang, „der“, notierte Witte, „wie die französische Republik verfassungsgemäß: eins und unteilbar sein sollte“. Statt sich dem Film wie einem Roman zu nähern, Inhalte nachzuerzählen und Botschaften aufzuspüren, hegten sie den Anspruch, die spezifische Ästhetik des Materials, die Bilder, die Töne, die Montage in den Blick zu nehmen.
Kritische Theorie und Kino
Die Zeit ist vorbei: Schütte ging 1999 in den Ruhestand, was er heute schreibt, findet sich im Netz. Koch wurde Professorin für Filmwissenschaft, ihre Ausflüge ins Zeitungsgeschäft, unter anderem auf die taz-Kulturseiten, wurden rar. Karsten Witte verstarb 1995 im Alter von 51 Jahren. Zuvor hatte er prognostiziert, dass er „einer jener Vertreter von Filmkritik“ sei, „die mit den Filmen, denen sie sich widmen, im Museum des Jahres 2000 verschwinden werden“. Das klang so resigniert, wie es gemeint war.
Was Schütte, Koch und Witte in der Rundschau betrieben, war insofern besonders, als es ein Labor war: Kritische Theorie und Kino landeten im Rundkolben und schlugen Funken. Siegfried Kracauer bildete einen wesentlichen Bezugspunkt; Witte etwa gab dessen Schriften heraus, und auch Adorno spielte eine zentrale Rolle, ohne dass sich die Autoren von dessen Strenge die Lust am Kino hätten nehmen lassen.
Die Laune nicht verderben lassen
Den dreien mochte es nicht vollständig gelingen, die Abwehrreflexe gegen populäre Kultur, die bei Adorno spürbar werden, zu überwinden. Dennoch trat an die Stelle der Bilderskepsis die Freude an der dichten Beschreibung und pointierten Analyse. Dies galt auch für Kochs Umgang mit feministischer Theorie – sie bezog sich darauf, ohne sich vom ideologiekritischen Impetus die Laune verderben zu lassen.
Widerspruch blieb nicht aus. Bei einer Ringvorlesung, die 1989 an der Freien Universität Berlin abgehalten wurde und die sich den konträren Positionen der Filmkritik widmete, trat der Konflikt offen zutage. Claudius Seidl, damals noch bei der Süddeutschen Zeitung, heute bei der FAS, behauptete mit Verve, Witte, Schütte und Koch trügen Scheuklappen: „Sie haben sich Bücher vor die Augen geschnallt.“
Schreiben könnten sie auch nicht, aus falsch verstandenem Expertentum heraus produzierten sie Satzungetüme und beleidigten damit die Intelligenz des Lesers. Seltsam, diese argumentative Volte: Warum beleidigen anspruchsvolle Sätze und Gedanken die Intelligenz des Lesers? Das klingt, als stellte sich einer künstlich dumm, um so die Anstrengung, die dem Gegenstand innewohnt, abzuwehren.
Roland Barthes hat diese Strategie einst als „stumme und blinde Kritik“ beschrieben; sie schickt sich umso lustvoller in den Narzissmus, je heftiger sie die Auseinandersetzung mit etwas, was außerhalb der eigenen Vorstellungswelt liegt, verwirft.
Keine Eleganz
Seltsam auch der Vorwurf, die Texte seien unverständlich und entbehrten der Eleganz. Man stößt darin nämlich nicht auf einen in Bücherseiten eingemauerten Sehsinn, sondern auf eine Menge Scharfsinn, auf hochkonzentrierte, dichte Beschreibungen und Analysen. Und auch wenn das Interesse vor allem dem Autorenfilm und besonders im Fall von Witte dem japanischen und afrikanischen Kino galt, so heißt das nicht, dass sich die drei in stumpfer Feindseligkeit gegenüber Hollywood ergingen. Kleine Kostprobe:
„Astaire hat den Fuß noch nicht aufgesetzt, da will er schon woanders hin“, schreibt Witte zum 80. Geburtstag des Tänzers, Sängers und Schauspielers. Und weiter: „So präzis seine Füße Punkte aufs Parkett setzen, so groß sind die Fragezeichen, die seine Arme in die Luft malen. Sie federn und balancieren den Körper aus, wo seine Beine drohen ihm davonzulaufen. Aus dieser kleinen Imperfektion, daß seine Arme und Beine oft auf verschiedenen Hochzeiten tanzen, erwächst der Charme.“
Gesten und Bewegungen so präzis zu erfassen muss einem erst einmal glücken. Die Emphase, mit der Schütte, Witte und Koch Erkenntnis und Aufklärung das Wort redeten, mag démodé sein; Überreste davon existieren heute in Nischen, in der potenziell unendlichen, dafür umso parzellierteren Öffentlichkeit des Netzes. In der Rückschau zeigt sich, welcher Verlust damit einhergeht. Wer die Texte der drei liest, lernt mehr zu sehen, als er mit bloßem Auge wahrgenommen hätte.






Leser*innenkommentare
Karl K
Gast
Lost in translation? 2.0
auf die frage von herrn karl k.:
Danke - schon bestellt.
Wenigstens mal einer, der soner faulen Socke
ohne Ansehung der Person unter die Arme greift.
Und wahrlich - unter Karsten Witte - änne von denne Linge - muß ich ja gar erschröckliche Dinge lesen " Ideologiekritik" usw - anäh - Pfuideibel;
immer nur dieses 'linge Zeigs '!
Da hat Adelbert Stifter … oder …Dickhut…?
aber irgendwie doch auch wieder irgendwie recht mit seiner Volte:
…Ressentiment, Ideologie, Propaganda…
wohin man schaut.
Genau.
carl-albert heller
Gast
Claudius Seidl, damals noch bei der Süddeutschen Zeitung, heute bei der FAS, behauptete mit Verve, Witte, Schütte und Koch trügen Scheuklappen: „Sie haben sich Bücher vor die Augen geschnallt.
frau nord, sie kennen den seidl, der muß sich nicht verstellen um künstlich dumm zu sein.
der war selbst vor seiner zeit bei der sz schon der vorreiter einer filmkritik mit der schrotflinte, irgendwas wird schon treffen.
betont jungkonservativ gegen die alte garde schütte/witte/restfilmkritik, und gegen damals noch kopfjunge leute wie blumenberg. sein lieblingsfilm war/ist "some came running". keine schlechte wahl. aber natürlich eine politische wahl.
bin froh, daß er heute bei der faz ist. daß er sich, wie so viele, seiner vergangenheit als filmkrtiker schämt (kilb), sagt alles.
---
auf die frage von herrn karl k.:
es gibt kein sammelwerk von den dreien (es gibt keine deutsche filmliteratur), aber es gibt einen sammelband mit texten von karsten witte, "im kino. texte vom sehen und hören", der auf dem portal zvab ab 2.95 euro, inklusive versand, zu kaufen ist.
in dem dieser leider tote mann seinen text über den leider letzten films meines lieblingsregisseurs nennt, wie nur karsten witte das kann:
ballett der vergeblichen gefühle.
es gab mal eine deutsche filmkritik, hat es immer gegeben. und seit knörer (der wolfram schütte&herbert linder der neo-brd combined) "nur" noch die dvds für die taz rezensiert, wird es auch nicht unbedingt besser.
whatevs.
danke jedenfalls für den artikel.
griffon
Gast
kerlekerlekerle
Karl K
Gast
Sorry - I forget:
gibt´s von den Texten der Dreien eine Sammlung/Buch?
By the way:
@von hans adalbert:
"Nicht anspruchsvolle Sätze und Gedanken beleidigen die Intelligenz des Lesers, sondern schlampig formulierte, pseudintellektuelle Phrasen, die keinen Dialog suchen."
Gebongt.
Nur "Die selstsame argumentative Volte kann man Ihnen genauso vorhalten."
Genau!( bitte mit der Stimme aus der Muppet-Show).
Und Claudius Seidl?
"....Kischs Texte, wenn man sie heute wiederliest, sind selten Beiträge zur Wahrheitsfindung und umso häufiger Ressentiment, Ideologie, Propaganda...."
Na bitte, da weiß man doch, was seine Kritik an den Gloreichen Drei der FR befeuerte und warum er schlußendlich bei der FAZ/FAS gelandet ist.
FAZ/FAS die - wie wir FR-Leser in den &0/70 sagten
(Herr Seidl war am Anfang dieser Zeit 1 Jahr alt - Gummibärchengeneration - immer zu spät dran, das tut weh!)
- noch im Kohlenkeller Schatten werfen.
.... Ressentiment, Ideologie, Propaganda...
Genau.
hans adalbert
Gast
Nicht anspruchsvolle Sätze und Gedanken beleidigen die Intelligenz des Lesers, sondern schlampig formulierte, pseudintellektuelle Phrasen, die keinen Dialog suchen.
Die selstsame argumentative Volte kann man Ihnen genauso vorhalten:
Auch bei Ihnen klingt es, "als stellte sich eine® künstlich dumm, um so die Anstrengung, die dem Gegenstand innewohnt, abzuwehren." Sie sind auf Seidls Replik nie inhaltlich eingegangen. Auch Ihr Spott ist deshalb „stumme und blinde Kritik“ und lustvoller Narzissmus, der sehr heftig "die Auseinandersetzung mit etwas, was außerhalb der eigenen Vorstellungswelt liegt, verwirft."
Karl K
Gast
Danke für diesen runden Artikel.
Mögen ihn sich alle Netz-Besoffenen hinter den Spiegel oder die taz stecken.
Was bildende Kunst anging, hatte ich das Glück,
mit Bekannten, Freunden meiner Mutter noch aus den
roaring twenties immer wieder durch Kirchen, Museen etc
streifen zu können.
Aber Film?
En familie nicht recht gelitten und
- bis Anfang der 60er " … in den öden Fensterhöhlen
wohnt das Grauen!"
Aber im Studium - Marburg - Altes Audimax mit "Limonaden Joe",
Studies als Cowboys und Zündplätzchen- Colt,
und dann aber in den Kinos " Wenn Katelbach kommt", "Zur Sache Schätzchen",
" Ekel", Clockwork Orange" !
Ja da kamen die Glorreichen Drei der FR gerade recht.
Hirn in die Weiche und ab dafür. Das Messer im Wasser, Weekend, Die Ferien des Herrn
Hulot, Mamma Roma - usw usw - ja, was erzählen die da eigentlich, und wie und warum genau.
Was hat das mit der realen Welt zu tun?
Heute inne taz? z.B. Knoerer, Nord, Seesslen - gewiß,
aber der Ansatz ist doch schon aus Platzgründen viel verhaltener;
es wird meist eher mitgeteilt a event - als über den Tellerrand hinaus gedacht!
Statements wie Jan Kruse et al. vs ZEITUNG rühren m.E. daher, daß ihnen
eine ZEIT mit einem Herausgeber J.M.M. ; eine FR wie beschrieben, schlicht unbekannt sind!
Kurz: Wer nur via http://www.mcdonalds.de fast food die Geschmacksnerven gebildet hat, sorry, aber was soll der mit ner Barberie-Ente anfangen?