Ein Reichsbürger und seine Tochter: Vaters Irrsinn, Leas Leiden
Leas Vater ist ein Reichsbürger, für den die Bundesrepublik Deutschland nicht existiert. Das hat Folgen für den Alltag seiner Tochter.

Leas Vater dürfe das alte Jagdgewehr nicht mehr besitzen, erklärt die Staatsanwaltschaft Foto: imago/Blickwinkel
DRESDEN taz Lea kann seinen Atem spüren. Ihr Freund steht dicht vor ihr, umschließt ihre Hände. Es ist einer dieser schönen Momente, die sie so fürchtet. Sie blickt ihm in die Augen. Die treten hervor. Die Mundwinkel fallen. Sie sieht nicht ihren Freund. Sie sieht ihren Vater. Den Reichsbürger.
Ein Treffen in Dresden. Lea hat ein Café in der Innenstadt gewählt, um ihre Geschichte zu erzählen: Leas Eltern beeinträchtigen alles in ihrem Leben, ihre Karriere, ihre Gesundheit, ihr Liebesleben. Ihretwegen hat sie Ärger mit Ämtern und Behörden, und immer wieder mit Gerichtsvollziehern und der Polizei zu tun. Über ihre Familie, das ist Leas Bedingung, spricht sie nur, wenn sie nicht erkannt werden kann. Sie heißt eigentlich anders.
Wie lebt es sich mit einer Familie, die glaubt, die Bundesrepublik Deutschland würde nicht existieren? Was bleibt von den Eltern, wenn die sich in ihrem Kampf verschanzen?
Der Verfassungsschutz beobachtet die Szene. Rund 15.000 Reichsbürger gibt es laut Bundesamt. Im vergangenen Jahr haben zwei von ihnen in Bayern auf Polizisten geschossen, einer ist gestorben. Auch Leas Eltern haben ein Jagdgewehr. Ein Erbstück, sicher verwahrt in einem Bankschließfach, sagt Lea. Ihre Eltern seien bescheuert, aber nicht gefährlich. Hat sie so auch der Polizei gesagt. Die Polizisten haben gewisse Zweifel geäußert.
„Es sind nun einmal meine Eltern“
Leas Eltern halten sich nicht für Reichsbürger. Aber sie machen, was Reichsbürger nun mal so machen. Sie leugnen den Staat, schreiben Beschwerden an den Bundespräsidenten und weigern sich, Steuern zu zahlen. Für sie ist Deutschland nichts weiter als ein Unternehmen, gelenkt von den Alliierten. Leas Vater hat seinen Personalausweis auslaufen lassen, immer wieder steht er vor Gericht. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft: Er sei mit einem nicht versicherten Auto gefahren, unerlaubter Waffenbesitz, Nötigung eines Gerichtsvollziehers. Wie es zu all dem kommen konnte? „Ein Scheißleben voller beschissener Zufälle“, sagt Lea.
Leas Mutter zeigt in den Himmel. Weiße Streifen durchziehen das Blau. „Da!“, ruft sie, „sind sie doch, die Chemtrails!“ Lea entgegnet: „Das sind Kondensstreifen von Flugzeugen!“ Die Mutter fragt: „Wirklich?“
Lea ist 22 Jahre alt, ihr Körper ist gebrechlich. Das rechte Bein zieht sie nach. Am rechten Handgelenk trägt sie eine Schiene, um eine komplexe Nervenentzündung zu kurieren. Lea hat Migräne und eine Autoimmunkrankheit, muss täglich Tabletten schlucken. Die chronischen Kopfschmerzen, habe ihr Arzt gesagt, rührten vom hausgemachten Stress.
Fragt man sie nach der Beziehung zu den Eltern, verzerrt sie die Stimme, als wäre das alles nur ein Scherz: „Joa, schwierig, ’ne?“ Fragt man sie später noch einmal, lacht sie nicht mehr. Sie schnauft, rührt im Kaffee, starrt in die Tasse. Sie habe schon oft, sehr oft drüber nachgedacht, den Kontakt abzubrechen. „Aber sie sind nun mal meine Eltern.“ Sagt sie ständig.
Vom Abgleiten des Vaters
Lea wächst in einer Großstadt im Ruhrgebiet auf. Ihre Eltern arbeiten viel, auch am Wochenende, Lea lebt deshalb bei ihren Großeltern mütterlicherseits. Ihr Vater ist selbstständiger Tischler, ihre Mutter hilft ihm im Büro und besucht abends das Kind. Den Vater sieht Lea so gut wie nie. Lea erinnert sich an eine gute Kindheit – bis sie zu ihren Eltern zieht. Inzwischen sind die Großeltern verstorben, der Krebs hatte erst ihre Oma geholt, später ihren Opa und Lea ist froh darüber. Müssten sie die Reichsbürger erleben, sagt Lea, sie würden jeden Tag einen kleinen Tod sterben.
Leas Jugend spielt fast nur in ihrem Kinderzimmer. Will sie mit Freunden ein Eis essen, muss sie ausbüxen. Besuch hat sie fast nie, Bücher und Computerspiele sind ihr Ersatz. Sie ist viel zu Hause, draußen, das sind für sie Schule und das Pflegepferd.
Als er 50 Jahre alt ist und sie zwölf, erleidet der Vater einen Bandscheibenvorfall. Als Tischler kann er nicht mehr arbeiten. Er will umschulen. Doch das Arbeitsamt erklärt ihm, er sei dafür zu alt. Er soll Pförtner werden. Will er nicht. Er macht auf Immobilienmakler. Und verliert eine halbe Million Euro. Kunden hätten ihm Geld nicht zurückgezahlt, das er ihnen vorgestreckt habe. Er zieht vor Gericht. Und verliert, weil er sein Recht nicht beweisen kann, sagt Lea. Er ist pleite und arbeitslos. Und beginnt zu schreien.
Der Vater ist jetzt immer zu Hause. Hat Lea Pech, schmeißt er mit der Fernbedienung nach ihr. Hat sie Glück, schreit er nur – morgens und mittags im Keller, abends zwei Zimmer weiter, bei Gelegenheit ihr ins Gesicht. Besonders schlimm ist es, als Lea ihr Abitur schreibt. „Es gibt kein Deutschland!“ oder „Scheiß Firma“ brüllt er immer wieder. Oft fährt Lea schon um fünf Uhr morgens in die Schule und lernt, während die Putzfrauen um sie herum wischen. Nach den Prüfungen besucht sie ihre Oma väterlicherseits. Und schläft.
Wie Kondensstreifen zur Giftwaffe werden
Vergangenen Sommer fährt Lea mit ihrer Mutter zum Reitstall, erzählt sie. Die Sonne scheint, leuchtende Rapsfelder fliegen vorbei. Ihre Mutter zeigt mit dem Finger in den Himmel. Weiße Streifen durchziehen das Blau. „Da!“, ruft sie, „sind sie doch, die Chemtrails!“ Lea lacht. „Ja, ja, die Regierung macht uns alle dumm!“ Ihre Mutter, ernst: „Genau!“ Lea entgegnet: „Kondensstreifen, Mutter. Das sind Kondensstreifen von Flugzeugen!“ Die Mutter fragt: „Wirklich?“
Anfangs hat Leas Mutter nur die Stirn gerunzelt, wenn ihr Mann von der „Deutschland-GmbH“ quasselte. Inzwischen nickt sie. Aus Loyalität, glaubt Lea. „Und weil sie sonst kaum noch jemanden hat.“ Für Lea ist sie viel mehr Mutter als Reichsbürgerin. „Bei ihr ist es auch irgendwie putzig, weil sie absolut keine Ahnung hat.“ Übel nimmt Lea ihr nur, dass sie ihren Vater nicht den Kopf gewaschen hat. „Jetzt ist es zu spät.“
Nach dem Abitur, vor gut zwei Jahren, zieht Lea aus. Sie will studieren. Architektur. Und einfach nur weg. Seither trennt die Bundesrepublik die Familie nicht nur in ihren Ansichten, sondern auch in ihrer gesamten Breite. Die Eltern wohnen im Ruhrgebiet, Lea in Dresden. Luftlinie: 450 Kilometer.
Wie der Vater zurückkehrt
Sie ist noch nicht lange weggezogen, da fischt Lea einen Brief aus ihrem neuen Briefkasten in Dresden. Von der Polizei. Ihr Vater soll einen Gerichtsvollzieher bedroht haben. Sie soll aussagen.
Ist ihr Vater gewalttätig? Hat er ihnen schon mal etwas getan? Würde er auch mal auf den Gerichtsvollzieher losgehen? Es ist die Zeit, als die deutschen Behörden erkennen, dass viele Reichsbürger zwar Spinner sind. Aber auch gefährlich.
Lea glaubt, das Urteil über ihre Eltern überall in ihrem Leben zu spüren. „Ach, du bist doch die Tochter von den Spinnern“, hört sie immer wieder. Eine Mitarbeiterin im Bürgerbüro habe ihr sogar einmal ins Gesicht gesagt, dass sie als „Pack“ das Kindergeld gar nicht verdiene. Lea glaubt auch, dass die Behörden sie beobachten. Die Polizeistreife vor ihrer Wohnung, die ist verdächtig oft dort, findet sie. Und warum wollte man ihr damals den neuen Reisepass erst aushändigen, als sie beteuerte, nicht viel mit ihren Eltern zu tun zu haben?
Lea ist so etwas wie der Kollateralschaden im Kampf ihrer Eltern. Mal leihen sie sich von ihrer Tochter Geld, wenn der Gerichtsvollzieher zum Pfänden kommt. Seit diesem Jahr unterschreiben sie ihren Antrag auf Bafög nicht mehr. „Sie schaden lieber mir, als das ‚System‘ zu stützen.“ Jetzt muss Lea einen Härtefallantrag stellen. „Schön, wenn man den Leuten beweisen muss: Ja, meine Eltern sind ein bisschen Banane im Kopf.“ Ohne Bafög bliebe ihr nur das Kindergeld, genau 192 Euro.
Wo Lea hingeht, ihre Eltern folgen ihr
Ein Sommerabend im vergangenen Jahr, eine Freundin aus dem Heimatort ruft an. „Ich muss dir was erzählen“, sagt die Freundin. „Was denn?“ – „Dein Vater ist gerade von Polizisten vom Fahrrad gerissen und mitgenommen worden.“
Leas Vater dürfe das alte Jagdgewehr nicht mehr besitzen, erklärt die Staatsanwaltschaft. Seine Besitzkarte dafür sei abgelaufen. Er muss dafür vor Gericht. Er selbst wiederum hat die Polizisten angezeigt. Bei der Festnahme hat er sich zwei Rippen gebrochen. Das Amtsgericht und die Polizei prüfen den Vorfall. Mehr wollen sie dazu auf Anfrage nicht mitteilen. Es werde noch ermittelt.
Egal wohin Lea geht, ihre Eltern folgen ihr. Vor ihren persönlichen Problemen kann sie ohnehin nicht fliehen. Sie ist nicht gern allein, nur oft lieber als zu zweit. „Ich kann gut auf Menschen zugehen, aber mich nur schwer auf sie einlassen.“ Denn da ist immer diese Angst. Ist die Person auch wirklich so, wie es scheint? Oder nicht doch ganz anders, als sie denkt? „Man sieht es ihnen ja nicht an. Bei meinen Eltern steht auch nicht ‚Reichsbürger‘ drauf.“ Lea traut selbst denen kaum noch, die ihr nahe sind. Ihr Freund sei deshalb inzwischen ihr Ex.
Lea hat im Studium einige Freunde gefunden, scherzt mit ihnen sogar über ihre Eltern. „Ich habe mir einen Arschtritt verpasst, sonst wäre ich jetzt wieder alleine.“ Das Verhältnis zu ihrem Vater ist nur weniger schlecht geworden – um etwa 450 Kilometer. „Wäre ich nicht umgezogen, hätten wir keinen Kontakt mehr.“ Lea muss ihn kaum noch sehen. Und kann auflegen, wenn er brüllt, weil sie wählen geht oder „merken“ sagt und er an Merkel denkt. „Er kann nicht anders. Es ist wie ein Zwang.“ Ob es noch mal besser wird? Glaubt sie nicht. Altersweisheit? „Er ist 60. Muss ich noch zwanzig Jahre warten?“
Lea geht nicht mehr ans Telefon
Kurz vor Weihnachten sprengen Polizisten des SEK mitten in der Nacht die Eingangstür von Leas Elternhaus. Zwangsräumung. Leas Eltern wollten partout nicht ausziehen, obwohl das Haus bereits versteigert worden war. Wie es dazu kommt? Wie Lea davon erfährt? Wie es weitergeht? Lea geht seitdem nicht mehr ans Telefon.
Lea, die Grundschülerin, hält eine Pistole in ihren Kinderfingern. Sie richtet sie auf den Mann mit dem Geldkoffer, kneift ein Auge zusammen. „Peng, Peng!“, macht sie und schnippt ihn um. Er ist aus Lego. Ihr Papa kommt ins Zimmer. Lea zieht einen kleinen gelben Handwerker aus dem Spielzeughaufen, hält ihm ihren Vater vors Gesicht. „Ich will sein wie du.“ Ihr Vater lächelt gequält, murmelt. „Nee Kleine, das willst du nicht.“



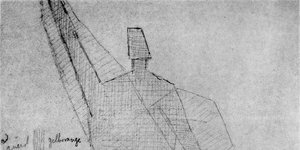
Leser*innenkommentare
Thomas Schöffel
In der sogenannten Reichsbürgerbewegung gibt es offenbar jede Menge Personen, die den Entscheid des Bundesverfassungsgerichtes BVerfG, 1956-08-17, 1 BvB 2/51, BVerfGE 5, 85 nicht kapieren. Beim vom Gericht bestätigten Fortbestand des Deutschen Reiches ist selbstverständlich nicht (!) das sog. „dritte Reich“ mit der Nazidiktatur gemeint, sondern das zweite Deutsche Reich von 1871, bzw. die Weimarer Republik -die erste wirklich demokratische Staatsstruktur auf deutschem Boden- die offiziell eben auch Deutsches Reich hieß. Die Nazis hatten anfänglich die Bezeichnung „drittes Reich“ ausgegeben, sind davon aber zwei Jahre später wieder abgerückt, weil sich die Bevölkerung darüber lustigmachte, indem sie Hitler als Kaiser verspottete und nach dem vierten Reich frug. Wenn also die sog. Reichsbürger glauben, daß mit dem vom Gericht bestätigten Fortbestand des Reiches ihr drittes Reich inklusive Hakenkreuz gemeint sei, irren sie gewaltig.
Boris Zeh
Also ich finde es eine Beleidigung an meine Intilligenz diese zusammengebastelte fiktive Geschichte aus Adrian ursache diesem"polizistenmörder" und was da sonst noch in der Szene rumkreucht, hier als wahre Geschichte zu verkaufen. Und meine Mitleser glauben den Unsinn noch. Schreiben sie doch eine fiktive Story, wie sie sich zu hauf in D abspielen könnte.
baukal
Wo Lea schon den Weg zur TAZ gefunden hat, könnte sie ja auch mal einen Profi konsultieren, um sich von ihren Elterm abzunabeln.
Falls das Erbgewehr tatsächlich existiert, in einem Bankschliessfach liegt und tatsächlich keine WBK dafür existiert, wäre es ein leichtes die Waffe einzuziehen. Bei mir als Jäger wäre die Behördenzündschnur jedenfalls bedeutend kürzer.
Der Artikel liest sich wie ein Pausenfüller.
Age Krüger
Mit verrückten Eltern haben viele Probleme, die kommen aber bei den meisten erst später. Alterspsychosen und -demenz können für die Anverwandten immer sehr hart sein.
Interessant ist hier die detaillierte Schilderung, die tatsächlich mal einer Überprüfung bedarf. Das hört sich bei dem Vater alles an wie eine paranoide psychotische Störung oder zumindest wie eine psychische. Auch Lea entwickelt nunmehr solche Verfolgungsgedanken. Ich schätze, dass man gerade bei Reichsbürgern eine Menge dieser Probleme finden kann, die niemand erkennt oder die niemand für behandlungsbedürftig hält.
Letztendlich hat sich Lea ja abgesetzt und nun schadet dieses Verhalten nur noch der Ehefrau, die sich aber zumindest lt. Leas Aussagen lieber damit arrangiert als anzuerkennen, dass ihr Mann wohl einen psychischen Schaden hat.
hessebub
Reichsbürger, Salafisten etc. sind die Baghwan-Jünger von heute. Verkrachte oder verlorene Existenzen, die in eine Ideologie flüchten, die ihnen Halt gibt und eine entlastende Erklärung für ihr Scheitern. Sehr traurig.
97760 (Profil gelöscht)
Gast
Man kann ja Probleme mit dem abstrakten Begriff Deutschland haben. Aber Warum sich gerade mit einer juristischen Konstruktion von vor 100 Jahren identifizieren?. Vor 2000 Jahren war es doch auch schön grün hier.
Strolch
Ist ja alles spannend. Aber ich hoffe, dass die Beschreibung von Lea falsch ist. Denn die Beschreibung ist so detailliert, dass jemand, der Lea kennt, diese im Artikel erkennt auch wenn der Name falsch ist.
Pink
Da muss ich Ihnen zustimmen.
Nun, vielleicht ist diese Beschreibung wirklich nicht realistisch.