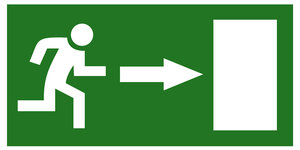Film „Alles ist gut gegangen“ im Kino: Komm, guter Tod
In seinem Spielfilm „Alles ist gut gegangen“ erzählt François Ozon von Sterbehilfe. Der Gefahr des Pathos weicht er geschickt aus.

Widerstand zwecklos: Emmanuèle (Sophie Marceau) und ihr Vater André Bernheim (André Dussollier) Foto: Panorama Entertainment
Es ist paradox: Menschen wollen gut leben, doch sterben meistens schlecht. Meistens da, wo sie geboren werden, an einem unpersönlichen, funktionalen Ort: im Krankenhaus. Dort kommt es nicht selten zu Szenen wie dieser: Ein Mann liegt nachts im Krankenbett. Die Augen aufgerissen, die Unterlippe nach außen gestülpt, ein Augenlid hängt runter. Er schreit, windet sich, reißt die Schläuche heraus, die in der Nase steckten. Ein Gerät fiept. Krankenpflegerinnen eilen herbei, geben ihm eine Spritze, er verstummt.
Es ist eine Szene, wie sie so ähnlich oft wiederkehrt in François Ozons „Alles ist gut gegangen“, und sie ist immer wieder schwer erträglich. Nicht, weil sie schockiert, sondern weil sie so alltäglich ist – geht es doch im Moment des Verfassens dieses Texts Millionen Menschen so wie dem 84-jährigen André Bernheim (André Dussollier). Er hatte einen Schlaganfall, kann nicht mehr richtig sprechen oder gehen, nicht alleine essen oder trinken, ist desorientiert und unkoordiniert, kurzum: komplett abhängig.
Seine Töchter Emmanuèle (Sophie Marceau) und Pascale (Géraldine Pailhas) kommen ihn regelmäßig besuchen. Emmanuèle, die ältere, ist täglich bei ihrem Vater, füttert und unterhält ihn, verbringt Nächte auf einem Stuhl vor seinem Bett oder hört sich im Arztzimmer stoisch die schwer auszusprechenden Namen der Medikamente an, die ihrem Vater in hohen Dosen verabreicht werden.
Eines Tages bittet André sie darum, „es zu beenden“. Emmanuèle ist schockiert. Verweigert erst, doch merkt, dass es vergeblich wäre, den sturen Vater vom Sterbewunsch abzubringen. Sie kontaktiert einen Schweizer Verein für Sterbehilfe. Ihr Vater müsse selbst nach Bern kommen, um den Gifttrunk eigenhändig zu trinken. Emmanuèle vereinbart einen Termin, der weitere Verlauf des Films ist geprägt vom Gefühl eines Countdowns zum Tag X.
Sich freiwillig töten lassen
Dem französischen Regisseur gelingt es, die traurige Geschichte aus dem gleichnamigen Buch Emmanuèle Bernheims von 2014 weitgehend unsentimental zu erzählen. Seinen Protagonisten André inszeniert er als, wenn auch nicht unsympathischen, Kotzbrocken, der etwa befiehlt, nicht neben den „schrecklichen Schwiegereltern“ begraben zu werden.
Zudem retten harte Schnitte den Film immer dann vor zu viel Pathos, wenn er, großzügig gepfeffert mit Brahms’ melancholischer Klaviermusik, überzukochen droht: wenn André seiner Tochter den Löffel aus der Hand schlägt, mit dem sie ihn füttert, und sie eine Sekunde später im Mittelmeer schwimmt. Oder als die Schwestern im Restaurant gemeinsam weinen und kurz darauf blutige Szenen eines Splatterfilms zu sehen sind, den Emmanuèle danach auf dem heimischen Sofa schaut.
Die filmische Atmosphäre folgt dem Gemüt Andrés – und bleibt zu dem seiner Familie auf Distanz. Während André angesichts seines Endes auflebt und seine Töchter um einen Besuch im Lieblingsrestaurant bittet, leiden seine Töchter unter ihrer Mitverantwortung, auch wenn sie es inzwischen akzeptiert haben – ganz im Gegensatz zu Andrés Cousine, die aus New York einfliegt, um ihren Cousin davon abzuhalten. Wie könne er sich, fragt sie ihn als jüdische Holocaust-Überlebende, freiwillig töten lassen? Ein moralisches Dilemma, das jedoch nur kurz gestreift wird.
Vielmehr kehrt Ozon das Paradox vom guten Leben, das den Tod ignoriert, genüsslich um: Andrés scheinbar neue Lebenslust ist eine Todeslust. Ein Affekt, der gern unterdrückt wird – ist die Schulmedizin doch verpflichtet, auch todkranke Menschen am Leben zu halten, die das nicht wollen. Aktive Sterbehilfe, wird suggeriert, bedeutet Rückgewinnung von Autonomie.
Dass sie oft zu kurz kommt, zeigt Ozon gern beiläufig, per Kameraschwenk auf Andrés Handgelenk, das ein Armband mit Strichcode trägt. Kranke sind immer auch Kunden, Nummern, die verwaltet werden. Dass die Ethik von Sterbehilfe in solchen handwerklichen Kniffen statt langer Dialoge behandelt wird, ist typisch für Ozon, der von sich selbst in Interviews sagt, er kümmere sich nicht um Diskurse, sondern um das Filmemachen selbst.
Mit dem Realismus der Bilder sowie dem authentischen Spiel von Dussollier und Marceau stellt der Regisseur Fragen, die wehtun: Wie lässt sich gut sterben in einer Gesellschaft, die den Tod tabuisiert? „Das Bild, das eine Gesellschaft vom Tod hat, bestimmt die herrschenden Vorstellungen von Gesundheit“, heißt es in „Nemesis der Medizin“ des Philosophen Ivan Illich. Das Bild, das der Film zeichnet, ist ambivalent. Sein Titel ist gut gewählt. Am Ende ist nicht klar, was eigentlich gut gegangen ist. Das Leben? Das Sterben? Oder die kurze Zeit dazwischen?