IP-Adressen: Die Nummer für's Leben?
Der Umstieg auf die neue Internet-Technik IPv6 ist unvermeidlich. Doch viele Fragen sind offen. Den Umgang mit Privatsphäre im Netz kann die Technik wesentlich beeinflussen.

Tor zur Welt: Netzwerkverbindungen leiten Daten in alle Welt - dank IP-Adressen. Bild: himberry / photocase.com
Die IP-calypse ist da. Am Donnerstag hat die Internet Assigned Numbers Authority (IANA) die letzten fünf großen Adresspakete in alle Welt vergeben: Je 16,8 Millionen IP-Adressen gingen an Unterorganisationen in den USA, Europa, Lateinamerika, Afrika und Asien. Dort werden sie aufgeteilt und an Provider vergeben, die sie wiederum an ihre Kunden verteilen. 16,8 Millionen Adressen, die genutzt werden können, um einen PC zu Hause ans Netz zu bringen, mit dem iPhone unterwegs zu surfen oder eine Webseite anzubieten.
„Wie lange die Provider damit auskommen, hängt von der Vergabegeschwindigkeit ab", erklärt Michael Rotert, Vorstandsvorsitzender des Verbandes der deutschen Internetwirtschaft eco. Danach ist Schluss: Alle 4,3 Milliarden IP-Adressen werden dann vergeben sein. Das Internet ist an seine Grenze gestoßen.
Doch akute Gefahr besteht nicht. Eine neue, sechste Version des Internet-Protokolls 6 – kurz: IPv6 – steht schon seit Jahren in den Startlöchern. Rund 340 Sextillionen IP-Adressen sind mit dem neuen Protokoll möglich, umgerechnet mehr als 600 Billionen IP-Adressen pro Quadratmillimeter Erdoberfläche. Für manche ist das schon wieder zu viel des Guten – sie befürchten, dass jedem Menschen quasi eine lebenslange IP-Adresse zugeteilt wird, dass aus der Anonymität des Netzes eine technische Vollerfassung wird.
Denn IP-Adressen sind der Dreh- und Angelpunkt für die Rückverfolgbarkeit von Personen im Netz. So beklagen Strafverfolger lautstark, dass sie seit dem Ende der Vorratsdatenspeicherung von deutschen Providern kaum noch Auskünfte erhalten, welcher Name zu welcher IP-Adresse gehört. Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger schlägt deshalb eine Speicherung von sieben Tagen vor, in der Ermittler ihren Bedarf nach Daten anmelden können. Schon dieser Kompromissvorschlag wird von Vertretern der Internet-Gemeinde als "Vorratsdatenspeicherung light" geschmäht.
Mit IPv6 könnte sich der Streit – zumindest, was die IP-Adressen angeht – schon bald erledigt haben. Denn mit der Einführung des neuen Protokolls verändern sich die Spielregeln im Netz wesentlich. So war es bisher üblich, dass Endkunden mindestens einmal am Tag eine neue IP-Adresse zugewiesen bekamen. Auf diese Weise sparten Provider knappe IP-Adressen. Nebeneffekt: ist die Verbindung zum Netz getrennt, ist – wenn überhaupt – nur wenige Tage nachverfolgbar, von welchem Anschluss eine Internet-Auktion gestartet, eine Webseite aufgerufen oder eine E-Mail verschickt wurde.
Nach der Einführung von IPv6 gibt es keinen technischen Grund mehr für diese ständige IP-Rotation. Statt täglich eine neue Adresse zu bekommen, könnte ein Internet-Anwender über Wochen, Monate oder gar Jahre zurückverfolgbar sein. Eine Speicherfrist beim Provider wäre so unnötig: Die Strafverfolger können einfach überprüfen, wer unter einer IP-Adresse aktuell erreichbar ist und hat mit hoher Wahrscheinlichkeit den gesuchten Anschlussinhaber ermittelt.
Datenschützer entdecken das Problem erst langsam. „Der Prozentsatz von Daten über Suchanfragen, die auf Einzelpersonen zurückgeführt werden können, wird vermutlich in der Zukunft weiter ansteigen", heißt es aus dem Büro des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Bonn auf Anfrage der taz - denn immer häufiger würden in Hochgeschwindigkeits-DSL oder anderen Breitbandverbindungen, bei denen die Computer der Nutzer ständig mit dem Netz verbunden sind, feste IP-Nummern genutzt. Eine abschließende Meinung hat man sich nicht nicht gebildet.
Und doch ist IPv6 kein Teufelszeug, kein Werkzeug aus dem Repertoire des Überwachungsstaates. So haben die Schöpfer des Protokolls eigens einen Privatsphären-Modus eingebaut. Der verhindert, dass sich jedes Gerät auf Dauer nachverfolgen lässt. Werden diese „privacy extensions“ ordnungsgemäß umgesetzt, ist die IPv6 im Prinzip nicht brisanter als das alte Internet-Protokoll – zumindest in der Theorie.
In der Praxis ist es jedoch ganz in der Hand der Provider, ob sie ihren Kunden auch in Zukunft dynamische IP-Adressen anbieten – und falls ja: wie oft die IP-Adressen wechseln sollen. Auf Presseanfragen reagieren die Provider sehr zurückhaltend. Allein Kabel Deutschland erklärt, dass man in Zukunft „semipermanente IP-Adressen“ verwenden werde. Was das konkret bedeutet, war nicht in Erfahrung zu bringen, aber schon heute ändern sich die IP-Adressen bei Internatanschlüssen per TV-Kabel nur noch sehr selten.
Immerhin scheint sich nun auch die Bundesregierung für die Folgen der neuen Technik zu interessieren, die sie zwar seit Jahren fordert und fördert, aber sonst nicht wirklich zur Kenntnis genommen hat. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie hat für die kommende Woche Vertreter der Internetwirtschaft zu einem Workshop eingeladen, in dem es um die praktischen Aspekte der Umsetzung der neuen Technik gehen soll. Ob am Ende Datenschützer oder Strafverfolger ihre Vorstellungen auf diesem Wege einbringen können, bleibt offen.


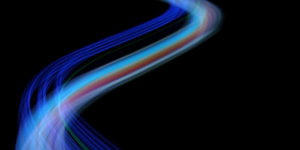
Leser*innenkommentare
Zafolo
Gast
Zitat:
> Nebeneffekt: ist die Verbindung zum Netz getrennt, ist – wenn überhaupt – nur wenige Tage nachverfolgbar, von welchem Anschluss eine Internet-Auktion gestartet, eine Webseite aufgerufen oder eine E-Mail verschickt wurde.
Das ist völliger Quark. Ich empfehle dem Autor, mal das Stichwort "Browser Fingerprinting" nachzuschlagen und die einschlägige Seite der Electronic Frontier Foundation aufzusuchen. Dazu kommen Flash Cookies, besonders in Gestalt von "Third Party Local Shared Objects".
Der fast aussichtslose Kampf um die Privatsphäre findet außerdem längst an einer ganz anderen weiteren Front statt: Firmen wie 123people.com führen Informationen über Privatpersonen - E-Mail Adressen, Fotos, Soziale Netzwerke, Blogs, Sportvereine, selbst die Kassenführerschaft für das Partyteam des Studentenwohnheims - zusammen. Der größte Hammer sind die Positionsdaten der Smartphones, aus GPS und WLANs. Dazu kommen Entwicklungen wie jene dass man in immer mehr Geschäften, von Karstadt & Co bis zum Edeka-Markt, vom vergleichsweise datensparsamen EC-Karten Verfahren zum Bankeinzugverfaren übergeht, erkennbar an der zu leistenden Unterschrift. Vieles davon ist zwar nicht eindeutig legal; Dass wegen solcher Praktiken jemand hinter Gittern oder beim Insolvenzverwalter gelandet wäre, wär mir aber neu.
Da die E-Mail Adresse zusammen mit den Browser Fingerprints als Missing Link zumeist ausreicht, wird aus den isolierten Datensammlungen mit lawinenartig anwachsender Geschwindigkeit in allernächster Zukunft ein einziger Datenklumpatsch, aus dem man ohne weiteres die Kreditwürdigkeit des Freundes der Tochter oder die bevorzugte Farbe der Unterwäsche der Geliebten des Nachbarn abfragen kann.
DAS ist das Problem, das uns bevorsteht - und zwar nicht in zehn Jahren, sondern in spätestens drei.
FAZIT: Ich wünsche mir in Zukunft eine erheblich solidere Recherche und fundiertere Berichterstattung zu solchen Themen. Insbesondere wenn das Augstein-Blatt es
gerade erheblich besser gemacht hat.
Rod
Gast
So langsam sollte es jedem klar werden, dass Privatsphäre gestern war. Nicht nur im Internet, auch im täglichen Leben! Handykameras mit Gesichtserkennung, oder auch überall allgegenwärtige Überwachungskameras, deren Daten auf zentralen Servern mit automatischer Gesichtserkennung zusammengeführt werden.
Nicht zuletzt reicht es, wenn Bekannte oder uns völlig unbekannte Personen Fotos auf Facebook einstellen - die automatische Gesichtserkennung von Facebook identifiziert uns. Facebook googelt automatisiert sämtliche unserer gespeicherten Daten aus und reichert in seinen internen Speichern die Daten, die wir selbst eingegeben haben mit anderen Daten an, die es über uns im Internet findet.
Die nächste oder übernächste Generation von Smartphones und anderen mobilen Geräten werden eine riesige Cloud bilden, die alles aufnehmen. Egal wo Du bist - Du wirst Dich nie mehr frei bewegen und äußern können.
Die Masse der Menschheit wird zu einer vernetzten und totalüberwachten Horde von Arbeitsdrohnen werden.
Hans Wurst
Gast
Man kann das auch positiv sehen: Feste IP-Adressen sind genau das, was Tor und I2P den Performance-durchbruch bringen könnte. Wenn sich Adressen nicht mehr ändern, bleiben Routinginformationen länger frisch. Das verringert indirekt die Latenz beim Onionrouting. Herkömmliches P2P dürfte auch schneller werden...
BiBo
Gast
Aeh, wozu die Aufregung? Durch die MAC Adresse, die z.B. auch in OfficeDokumenten gespeichert wird, ist eh jeder Rechner im Grunde schon zu identifizieren, wenn man die zweite Schicht des OSI Modells anspricht. PiffPaffPuff. Erinnere mich da an einem Coder von Markoviren, Bums MAC Adresse im Virus, bei AOL nachgefragt, Ende Aus Micky Maus.
By the way, das gibt es schon seit IPv4 in IPv6 wird dies vom NDP (ungleich NPD) Protokoll uebernommen.
Patrick H.
Gast
@m.b.:
Das sehe ich nicht ganz so. Genügend Datenschützer weißen schon lange auf die Probleme hin. Leider nicht immer konstruktiv, denn zum weitgehenden Umstieg auf IPv6 gibt es keine Alternative (man kann höchstens versuchen, es hinauszuzögern), es wird aber manchmal von IPv6-Gegnern und „Datenschützern“ so suggeriert. Dass Datenschutz-Probleme schon früh von den Protokoll-Machern selbst erkannt wurden, zeigt die Einführung von Privacy Extensions.
Jetzt muss man aber dazu sagen, dass IPv4 KEINESWEGS den besseren Datenschutzstandard bietet. Es ist vielmehr reiner Zufall, dass die Kombination der Krücken-Technologie NAT (deren Privacy-Effekt mit den gleichnamigen Extensions gleichwertig in IPv6 existiert) mit der aus ganz anderen Gründen getroffenen Entscheidung, Endkunden dynamische IP-Adressen zuzuweisen, ein vergleichsweise gutes Datenschutz-Niveau gewährleistet (allerdings nicht gegenüber User-Tracking durch Cookies oder andere Technologien).
Wir sind demnach jetzt dazu aufgerufen, Provider unter den Druck zu setzen, dieses Datenschutz-Niveau erstmals genau aus dem Grund Datenschutz zu gewährleisten. Dazu gehört auch, den AnwenderInnen zu sagen, dass ein Angebot „regelmäßiger dynamischer Adresspräfix-Wechsel“ ein Feature ist, dass sie bei ihrem Provider nachfragen sollten und das ein Grund zum Anbieterwechsel ist.
Frank
Gast
Man benoetigt genau 1 IP-Adresse um ein NETZWERK mit dem Internet zu verbinden (das kleinste private Netzwerk hat eben einen, kann aber auch viel mehr Maschinen beherbergen).
Die angeschlossenen Maschinen, das koennen theoretisch Hunderttausende sein, nutzen alle genau diese 1 Adresse und koennen ins Internet.
Viele kennen das, aus dem Funknetzwerk (Wlan) zuhause.
Eltern, Kinder, Oma und Opa, jeder hat einen Rechner.
Eventuell noch Handys oder andere internetfaehige Geraete.
-ALLE- diese Geraete koennen ueber 1 IP-Adresse (das Gateway) in das andere Netz, das Internet.
Was anderes ist es, WENN gewuenscht ist, das JEDE Maschine welche Zugang zum Internet hat, EINDEUTIG IDENTIFIZIERBAR ist.
Das ist BISHER nicht moeglich. Das private Netz, -hinter- der gemeinsam genutzten IP-Adresse des Routers (wie gesagt oft ein Wlan-Router) ist bisher prinzipiell vom Internet aus UNSICHTBAR.
(http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0812111.htm).
DAS wird aber moeglich mit IPv6 (Deshalb wird JEDER Rechner im Heimnetz nach Einfuehrung von IPv6 auch vom Internet aus, -SICHTBAR- sein).
Aber wie immer, ist hier jeder bestrebt nur das Beste zu wollen.. und wer nichts zu verbergen hat, hat ja auch nichts zu befuerchten...sagen zumindest Politik und Wirtschaft.
Andererseits, in Agypten, China und anderen Regionen wird an den guten Absichten, auch hierzulande, gezweifelt.
Da war doch was....irgendwas mit speichern oder auch abschalten...und ueberwachen glaube ich.
Stefan
Gast
Und es sind auch nicht alle 4,3 Milliarden Adressen vergeben. Alleine 1/8 davon (Alles ab 224.x.x.x aufwärts) ist reserviert und noch ein paar mehr fallen raus.
Andreas
Gast
Und wo ist das Problem? Es hat doch jeder selbst in der Hand nichts illegales zu machen!
m.b.
Gast
Datenschützer sind zum großen Teil sehr IT-begeistert und daher beim Thema IPv6 etwas blind. Sie sehen nur die technischen Neuerungen von IPv6 und blenden die Gefahren aus.
Chris
Gast
"4,3 Millionen"
das sind 4,3 Milliarden !
Genauer gesagt 2^32 (4294967296)
Stuhlio Oberlehrio
Gast
Nachtrag:
"dass jedem Menschen quasi eine lebenslange IP-Adresse zugeteilt wird, das aus der Anonymität des Netzes eine technische Vollerfassung wird."
eher: "dasS aus der Anonymität..."
"dass sie seit der Ende der Vorratsdatenspeicherung"
eher: "seit deM Ende..."
Stuhlio Iglesias
Gast
1. "Alle 4,3 Millionen IP-Adressen werden dann vergeben sein."
Sind es nicht insgesamt 4,3 Milliarden Adressen??
anon
Gast
"Danach ist Schluss: Alle 4,3 Millionen IP-Adressen werden dann vergeben sein."
Müsste eigentlich Milliarden heißen. (http://en.wikipedia.org/wiki/IPv4#Addressing)