Kürzungen im Kulturbetrieb: Kunst ist für alle da, und alle brauchen Kunst
Berlins Bürgermeister behauptet, Kassiererinnen würden nicht in die Oper gehen. Er baut damit eine mentale Barriere aus, an der auch Linke arbeiten.

D ie Verteidigung von Kunst und Kultur rückt auf meiner politischen Dringlichkeitsliste immer weiter nach oben. Ich bin nicht nur gegen Kürzungen, sondern für einen Ausbau der Kulturlandschaft und Aufstockung der Mittel.
Theater und Museen sind Orte, an denen Menschen zusammenkommen. An denen gemeinsam gesehen und gefühlt, analysiert und diskutiert wird. Um Menschen zusammen- und miteinander in Austausch zu bringen, braucht es reale Begegnungsorte in der Stadt: Orte, die keine Shoppingcenter sind. Das Internet verbindet uns wohl doch nicht.
Doch kaum geht es darum, dass Kultur-Orte auch finanziert werden müssen, fällt der Vorwurf, die Kunst sei elitär und diese Einrichtungen, obwohl oft mitten in der Stadt, seien gar nicht für alle da. Wenn man diesen Elitarismus-Vorwurf oft genug wiederholt, wird er auch wahr.
Wer Theater, Opern und Museen immer wieder als Orte des Bildungsbürgertums framed oder behauptet, Kunst sei nur etwas für Akademiker*innen, signalisiert allen anderen, sie würden dort nicht hingehören. So werden mentale Barrieren geschaffen, die davon abhalten, Kulturangebote wahrzunehmen.
Wenn Berlins Bürgermeister behauptet, Kassiererinnen würden eh nicht in die Oper gehen, sagt er eigentlich, dass er sich nicht vorstellen kann, in der Oper neben einer Kassiererin zu sitzen. Und als Ex-Senator Chiallo darauf verwies, die Kultur würde immerhin von ganz normalen Leuten finanziert, implizierte er damit nicht nur, dass Leute, die im Kulturbereich arbeiten, keine normalen Leute sind. Er sagt auch, dass normale Leute nichts von Kultur haben. Wer für die CDU noch als normal gilt, ist schwer zu sagen. Klar ist aber: Kürzungen in der Kultur führen zu einem weniger breiten Angebot und höheren Eintrittspreisen. Dadurch werden Veranstaltungen tatsächlich elitärer.
Viele wissen nichts von Sozialtickets oder den solidarischen Preismodellen
Für Konservative ist es taktisch klug, immer wieder das Elfenbeinturm-Argument anzuführen. Denn es ist anschlussfähiger, als zu sagen: „Die Kunst ist uns zu antikapitalistisch, zu feministisch und außerdem zu sinnstiftend und verbindend.“ Der Widerstand gegen die Kürzungen wäre wesentlich breiter. Doch Zeug für reiche Bildungsbürgis zu unterstützen, das finden auch Linke uncool.
In der Kultur wird mehr für Zugänglichkeit getan, als in vielen anderen Bereichen. Im direkten Gespräch fällt mir auf, dass viele die Eintrittspreise für Theater nicht nur generell zu hoch schätzen, sondern auch nichts von Sozialtickets oder den solidarischen Preismodellen wissen. Positive Veränderungen kommen nur langsam in der Öffentlichkeit an: Wer lange ausgeschlossen wurde, braucht eine Weile, um eine Institution als Ort wahrzunehmen, die man auch nutzen kann.
Es hat mich viel Arbeit gekostet, Menschen aus Schwarzen Communitys ins Theater zu locken, nach den Rassismuserfahrungen, die viele bei früheren Besuchen gemacht haben. Ich erlebe immer wieder, dass behinderte und neurodivergente Personen gar nicht auf die Idee kommen, auf Theaterwebsites nach Access-Informationen zu suchen, weil es sie so lange nicht gab.
Als Kulturschaffende sollten wir nicht nur laut widersprechen, wenn es heißt, Kunst sei nicht für alle. Wir dürfen auch nicht auf dieses Narrativ hereinfallen. Und wir müssen weiterhin Kunst für alle machen und auch allen davon erzählen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





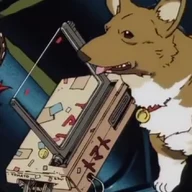
meistkommentiert
CSDs und die Mehrheitsgesellschaft
Queere Menschen machen es vor
Gaza-Tagebuch
Was eine fünfköpfige Familie an einem Tag isst
Frankreich zu Palästinenserstaat
Macron kündigt Anerkennung Palästinas im September an
Ob Männer- oder Frauenfußball
Deutscher Nationalstolz ist immer gefährlich
Israels Kriegsverbrechen in Gaza
Die Banalität des deutschen Nichtstuns
Rechte Heilpraktiker*innen
In der braunen Ecke der Pseudomedizin