Musiklabels gegen Spotify: Krach ums Streaming
Der Dienst Spotify hat ein Problem. Denn der Plattenvertieb ST Holdings hat seine Zusammenarbeit aufgekündigt - Musik-Streaming kannibalisiere den Verkauf.
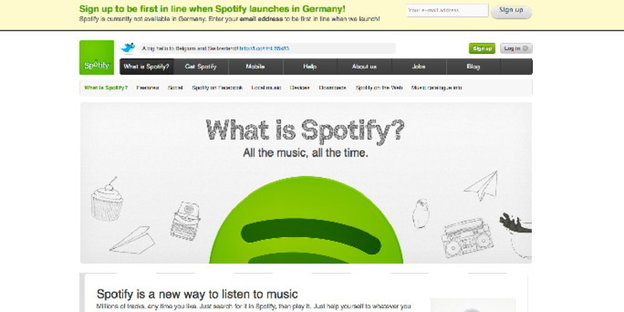
Mit dieser Seite wollen Musiklabels nicht mehr kooperieren: Online-Dienst Spotify. Bild: screenshot/spotify.com
Die Geschäftsbeziehung endete mit einem Knall. Vergangene Woche kündigte der britische Plattenvertrieb ST Holdings an, Musik von über 200 Labels nicht mehr über Streamingdienste wie Spotify, Rdio oder Simfy zu vertreiben. Als Konsequenz wäre auf einen Schlag die Mehrzahl britischer Bassmusik-Artists nicht mehr auf diesen Plattformen vertreten.
Das Internet-Streaming von Musik kannibalisiere den Musikverkauf, gab ST Holdings an. Das habe eine Studie des US-Musikbranchenverbands NARM ergeben. Ein häufiges Statement, aber diesmal schlug es hohe Wellen.
Der Elektronikmusiker Jon Hopkins kommentierte den Vorfall mit "Fuck Spotify". Für 90.000 Streams habe er 9 Euro erhalten. Und Gold Panda, der gerade eine Ausgabe der DJ-Kicks-Reihe kuratiert hat, bekannte, mit dem Streaming seiner Musik im letzten Jahr 22 Cent verdient zu haben. Hinter beiden Statements steht ein simpler Fakt: Während ein Musiker mit dem Verkauf eines 73 Cent teuren MP3s bei Itunes etwa 6 Cent verdient, bringt ein einmaliges Abspielen eines Stücks bei Spotify weniger als einen Viertelcent ein.
Zwar ist der Anteil der Künstler gegenüber dem Label bei Spotify sogar ein wenig höher, aber um die Summe eines gekauften MP3s zu erhalten, muss dasselbe Stück 310-mal gestreamt werden.
Mythos des Web 2.0: der "Long Tail"
Bei Spotify versteht man die ganze Aufregung nicht: "Mit einem MP3 kann man einmal pro Kunde Geld verdienen, mit einem Streaming auf Spotify viele Jahre lang", erläutert Spotify-Sprecherin Alison Bonny und fügt hinzu: "Bei Spotify kann ein Künstler auch mit dem ,long tail' seines Backkatalogs Geld verdienen."
Hier kommt ein Mythos des Web 2.0 ins Spiel: der "Long Tail". Weil es so günstig sei, digitale Produkte verfügbar zu halten, würden auch Nischenprodukte nachgefragt. Allerdings ist am Ende des langen Schwanzes die Nachfrage so gering, dass daran kaum verdient wird. Auch die 100 Millionen Euro, die Spotify nach eigenen Angaben an Künstler, Verwertungsgesellschaften und Labels ausgeschüttet hat, kommen in erster Linie den paar großen Acts der Majors zugute.
Die Indies lassen derweilen die Muskeln spielen. Zwar lässt die Studie der NARM den Schluss nicht zu, dass mit dem Rückzug aus den Streamingangeboten auch gleichzeitig mehr Musik verkauft würde, aber ST Holdings hat das kulturelle Kapital auf seiner Seite. Ihre Künstler, etwa Dubstep-Produzenten wie Scuba oder BenUFO, sind bei genau der Zielgruppe populär, für die Streamingservices bedeuten, auch technologisch irgendwie vorne mit dabei zu sein. Und Spotify braucht diese wiederum, um weiter für Investoren attraktiv zu bleiben.
Nirgendwo war das Entsetzen über den Rückzug von ST Holdings größer als auf den einschlägigen Technologieseiten. Die Konsequenz: Am Mittwoch erklärte Chris Parkinson von ST Holdings: "Wir stehen in Verhandlungen mit Spotify."




Leser*innenkommentare
iii
Gast
@Martin: falsch. Die GEMA für 1 mal Airplay schwankt zwischen 30 und 300 Euro - je nach Sender und Stück. Im Bereich "E-Musik" können das mithilfe der sogenannten "Materialgebühr" mehrere tausend Euro sein - z.B. bei Orchesterstücken, die weit über 30 Minuten gehen (gibt es tatsächlich - das Nachtprogramm der öffentlich-rechtlichen ist voll davon).
Der Long Tail ist ein Lügengebäude. Hat Stefan Goldmann schon vor längerem in seinem Web 2.0 Artikel schön dargelegt. Gabs auch in der TAZ.
martin
Gast
"[…] um die Summe eines gekauften MP3s zu erhalten, muss dasselbe Stück 310-mal gestreamt werden."
Äpfel und Birnen. Interessanter wäre ein anderer Vergleich: Wie viel Cent bekommen Label/Musiker denn pro Hörer für ein Lied das im Radio läuft? Das dürfte nämlich noch um einiges weniger sein.