Staatshaushalt in Coronakrise: „Schulden sind nicht das Problem“
Deutschland wird wohl glimpflich aus der Coronakrise kommen, sagt Ökonom Jens Südekum. Die Bundesregierung müsse dennoch aufpassen.

Die Immobilienpreise steigen, und auch gebaut wird weiter munter: Arbeiter in Duisburg Foto: Jochen Tack/imago
taz: Herr Südekum, die deutsche Wirtschaft erlebt ihre schwerste Krise in der Nachkriegszeit. Zugleich scheinen sich viele aber in Sicherheit zu wiegen. Die Immobilienpreise steigen, die Aktienkurse ebenso. Wie passt das zusammen?
Jens Südekum: Aktienkurse sind kein Indikator für den Status quo jetzt, sondern getrieben von Erwartungen. Investoren wissen, die Coronakrise ist in absehbarer Zeit zu Ende. Der Impfstoff ist da; es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er in der Breite ankommt. Diese Erwartungen treiben die Aktienkurse und ein Stück weit auch die Immobilienpreise. Die geldpolitischen Lockerungen tragen auch dazu bei.
Allein im November gibt die Bundesregierung 17 Milliarden Euro an Staatshilfe aus, im Dezember noch mehr. Vermittelt sie zu sehr das Gefühl „Alles im Griff“?
Ich glaube nicht, dass das der Treiber von hohen Aktienkursen ist. Ich nehme auch gar nicht wahr, dass die Leute in der Breite diese Krise auf die leichte Schulter nehmen. Ich vernehme viel Unsicherheit.
Wie ist die wirtschaftliche Lage?
Die Zahlen für 2020 sind dramatisch. Aber alle Prognosen gehen davon aus, dass wir 2021 ein kräftiges Wachstum haben werden. Trotzdem werden einige Branchen bleibende Schäden davontragen.
Welche bleibenden Schäden meinen Sie?
Wir wissen nicht, wie sich zum Beispiel das Reiseverhalten nach der Krise verändern wird. Werden die Leute nach der Krise wieder so umschalten und zu den gleichen Verhaltensweisen zurückkehren, als wäre nichts gewesen? Dann wird ja auch die Klimakrise wieder stärker Thema sein, die letztendlich die Frage aufwerfen wird: Müssen sich weiter massenhaft Leute ständig in den Flieger setzen, bloß um sich für einige Stunden irgendwo zu treffen? Corona hat in diesem Bereich ein Umdenken ausgelöst. Für die Flug- oder auch die Hotelbranche dürfte es hart bleiben. Entsprechend fallen dann auch Arbeitsplätze weg. Alles, was mit digitalen Konferenzen und Homeoffice zu tun hat, wird zulegen. Und dann stellt sich die Frage: Wie viele zusätzliche Arbeitsplätze werden in diesen Bereichen entstehen und bringt das etwas für die Leute, die anderswo ihre Arbeitsplätze verloren haben? Dieser Strukturwandel wird sicherlich eine große Herausforderung nach Corona sein.
Immer mehr scheint sich herauszukristallisieren: Vermögende trifft die Krise nur wenig, wegen steigender Aktienkurse vergrößert sich ihr Vermögen sogar. Im Niedriglohnsektor hingegen sind viele auf Kurzarbeit oder haben ihre Jobs ganz verloren. Wie ließe sich das besser steuern?
Einige werden sehr von der Krise profitieren. Jeff Bezos von Amazon ist natürlich ein ganz großer Krisengewinner. Menschen aus dem Niedriglohnsektor hingegen leiden. Wir erleben eine weitere Verschärfung bei der Vermögens- und Einkommensungleichheit. Die Diskussion darum, wie man dieses Missverhältnis korrigieren kann, sollte auch unbedingt geführt werden. Ich warne nur davor, das mit der Coronakrise zu vermischen. Es gibt jetzt ja die Forderung: Wir brauchen eine Vermögensabgabe, um die Coronakrise abzubezahlen. Diese Verknüpfung halte ich für falsch. Um die Coronakrise zu finanzieren, brauchen wir keine zusätzlichen Steuern, sondern sollten sie im Wesentlichen über Wirtschaftswachstum abtragen.
Jens Südekum

Foto: Stefan Boness/imago
ist Professor für internationale Volkswirtschaftslehre des Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.
Da sind wir bei dem Thema Staatsverschuldung: Die Pandemie wird im Dezember ja nicht beendet sein. Bis März werden wahrscheinlich weitere 20 bis 30 Milliarden an Hilfe nötig sein. Kann der Bund auch das weiter stemmen?
Der Anstieg der Staatsverschuldung ist gar nicht so extrem. Er ist niedriger als nach der Finanzkrise. Nach aktuellen Projektionen geht die Schuldenquote von knapp unter 60 auf etwa 72 Prozent hoch. Ich halte die Staatsverschuldungsquote aber generell nicht für besonders aussagekräftig. Viel wichtiger ist die Frage: Wie hoch sind die Zinsausgaben, die der Staat tätigen muss, um diese Schulden zu bedienen? Und diese Kennziffer ist auf einem Tiefststand. In dieser Krise hat sich bei den Zinsen der Staatsanleihen überhaupt nichts getan. Sie sind sogar leicht gesunken. Das heißt, der Staat muss für die zusätzlichen Schulden gar nicht zahlen, sondern verdient sogar daran. In so einem Umfeld, das noch lange so bleiben wird, sind Staatsschulden nicht das größte Problem.
Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) warnt nun aber vor einem zu hohen Schuldenstand, der Staat komme ans Ende seiner Handlungsfähigkeit.
Ich halte diesen Satz nicht nur für falsch, sondern zu diesem Zeitpunkt sogar für gefährlich. Die Pandemie ist doch in absehbarer Zeit ausgestanden. Jetzt zu sagen, wir müssen bei den Hilfen auf die Bremse treten, wird Geschäftstreibende massiv verunsichern. Seit Beginn der Pandemie war es das Ziel, die Unternehmen und die Arbeitsplätze zu erhalten. Wenn Helge Braun daran jetzt Zweifel sät, dann werden viele doch noch den Weg in die Insolvenz gehen. Dann hätte man sich aber die bisher geleisteten Hilfen sparen können. Sie wären komplett verpufft. Ich glaube nicht, dass das so kommen wird. Aber mit Aussagen vom Ende der staatlichen Handlungsfähigkeit sollte das Kanzleramt extrem vorsichtig sein.
Sollten zumindest nicht die Länder stärker zur Kasse gebeten werden?
Ob Bund oder Länder – diese Frage halte ich für uninteressant. Zwar bekommen die Länder einen großen und sogar noch wachsenden Teil der Steuereinnahmen. Insofern ist es richtig, dass sie sich an den Kosten beteiligen. Doch die Schuldenregelungen sind so streng, dass die Länder im Rahmen der Schuldenbremse noch weniger Spielraum haben als der Bund. Wir müssen diese Krise aber über Verschuldung lösen, und das kann der Bund einfach professioneller. Makropolitik sollten nicht die Länder machen, schon gar nicht die Kommunen. In letzter Konsequenz steht der Bund eh ein.
Wo wird die deutsche Wirtschaft in einem Jahr stehen?
Wir haben alle keine Glaskugel. Aber da jetzt absehbar ist, dass der Impfstoff kommt, gehe ich davon aus, dass wir einen Großteil der Schäden wettgemacht haben werden. Im europäischen Vergleich wird Deutschland wahrscheinlich mit am besten durch die Krise kommen. Daraus ergibt sich jedoch ein Folgeproblem: Die Divergenzen innerhalb der Eurozone werden weiter zunehmen. Länder, die vorher schon schwächelten, werden wohl noch stärker hinterherhinken.
Droht ein Revival der Eurokrise?
Das muss nicht so kommen. Aber dann dürften wir nicht die Fehler wiederholen, die wir vor der Eurokrise gemacht haben. Der European Recovery Fund, der derzeit von Ungarn und Polen blockiert wird, muss schnell und zielgerichtet loslegen. Und die Europäische Zentralbank muss bei ihrem Kurs bleiben. Ein übereiltes Ende ihres Pandemie-Notfallankaufprogramms – und die Eurokrise wäre schneller wieder da, als wir gucken können.
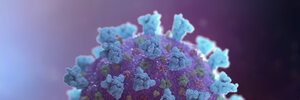


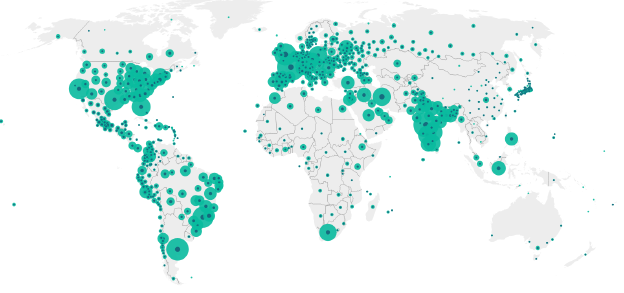




Leser*innenkommentare
Ajuga
"Im europäischen Vergleich wird Deutschland wahrscheinlich mit am besten durch die Krise kommen."
Sehr optimistisch. So ziemlich kein anderes Land in Europa steht in der "zweiten Welle" so schlecht da wie Deutschland. Die Packung, die Italien, Spanien, Frankreich, UK im Frühling kassiert haben, kassiert Deutschland jetzt. Und generell scheint Herrn Südekums Europakarte an Schlei und Bug zu enden. Oder gehören Dänemark, Norwegen, Finnland und das Baltikum jetzt zu Asien? (Finnland ist vielleicht das europäische Paradebeispiel für eine gutintegrierte Covid-Strategie. Wirtschaftlich stehen sie wesentlich besser da als die Eurozone oder Schweden. Die aktuellen Eindämmungsmaßnahmen sind unter den leichtesten in Europa - weil man es kann. Sanna Marin hat mit ihren 35 Jahren mehr geleistet als so ziemlich jede*r Regierungschef*in außerhalb von Afrika und der Pazifikregion.)