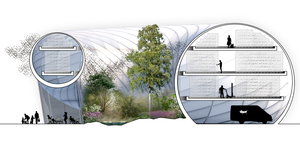Zeichentrickfilm „Prinzessin Kaguya“: Eine Welt aus Linien und Farben
Mit ihr verliert die Welt ihre Konturen. Der Film „Die Legende der Prinzessin Kaguya“ zelebriert die Schönheit von Hand gefertigter Bilder.

Prinzessin Kaguya lernt von den Fröschen laufen. Bild: Universum Film
Als der Bambussammler Okina die spätere Prinzessin Kaguya in einer Bambusstaude oder genauer: in gleißendem weißem Licht, aus dem heraus sie ihn mit offenherzigem Augenaufschlag anblickt, entdeckt, ist sie noch so klein, dass er sie in seinen Händen verbergen kann. Doch schon während er sie seiner Frau überreicht, beginnt sie zu wachsen und hat, buchstäblich im Handumdrehen, die Größe eines gewöhnlichen Säuglings erreicht.
Diese bezaubernde Szene einer zweiten Geburt nimmt nur wenige Sekunden Filmzeit in Anspruch – das heißt in diesem Fall: ein paar hundert gezeichnete Bilder. Denn „Die Legende der Prinzessin Kaguya“ ist ein Zeichentrickfilm, der, von wenigen computeranimierten Passagen abgesehen, komplett von Hand gefertigt wurde. Diese Technik ist, zumindest was großformatige kommerzielle Produktionen betrifft, im Aussterben begriffen.
Kaum ein Film könnte eindringlicher deutlich machen, was das Kino an ihr und an dem legendären japanischen Studio Ghibli, das „Die Legende der Prinzessin Kaguya“ produzierte und unlängst angekündigt hat, bis auf Weiteres keine neuen Projekte mehr in Angriff nehmen zu wollen, zu verlieren droht.
Bildraum mit flächiger Farbigkeit
Im Zeichentrickfilm besteht die Welt aus Linien und Farben. Was das heißt, kann man in „Die Legende der Prinzessin Kaguya“ besonders gut nachvollziehen, weil die Linien wie mit einer Tuschefeder prägnant und nicht immer gleichmäßig gezogen sind, oft eher skizzenhaft hingeworfen wirken; und weil die Farben den Raum zwischen den Linien nicht exakt ausfüllen, sondern wie in der Aquarellmalerei über sie hinausschießen, den Bildraum mit flächiger Farbigkeit überschwemmen, anstatt einfach nur Vorgefertigtes anzumalen.
Es ist umso rührender, wenn aus diesen mit einfachsten Mitteln gefertigten antirealistischen Bildern trotzdem Figuren, Geschichten, Leben entstehen.
Die andauernde Verlebendigung der Linien und Farben dominiert vor allem den Anfang des Films. Kaguya lernt von den Fröschen laufen, tobt, umgeben von Insekten und Vögeln, mit anderen Kindern durch die Natur, nähert sich dem Nachbarsjungen Sutemaru an. Währenddessen setzt sich ihr rapides Wachstum fort – und dann muss sie urplötzlich das Dorf verlassen, weil ihr Ziehvater die Chance wittert, durch ihre Schönheit in der Stadt zu Reichtum zu gelangen.
Befreiung und Gefängnis
Hier in der Stadt dominieren die rechten Winkel einer unbarmherzigen, wie mit dem Lineal gezogenen Architektur. Die Linie kann beides sein, Befreiung und Gefängnis, sie kann Leben hervorbringen und auch wieder stillstellen. Das ist die basale Ambivalenz, die der Film auf unterschiedlichen Ebenen – erstaunlich komplex und gleichzeitig herzerweichend – auffaltet.
Grundlage ist das „Taketori Monogatari“, eine Sage aus dem 10. Jahrhundert. Isao Takahata, der fast 80-jährige Regisseur des Films, destilliert aus dem Stoff die feministische Geschichte einer Frau, die sich dagegen wehrt, den ihr sozial vorgezeichneten Platz in einer durchritualisierten Welt einzunehmen. Tatsächlich verhärtet sich nicht nur die Welt um Kaguya, sobald sie die Stadt betritt; auch sie selbst wird neu gezeichnet, gemäß der Etikette für japanische Damen aus gutem Haus: Ihre Augenbrauen werden mit Kohle nachgezogen, ihre Zähne geschwärzt.
Zugleich ist es Kaguya selbst, die die festgefahrenen Linien immer wieder deformiert, die eingesperrten Farben befreit. Als ein nicht zu bändigender grafischer Unruheherd wirbelt ihre zierliche, ungestüme Gestalt durch die streng parzellierte Welt. Wenn sie in einer Sequenz dem Gesellschaftsgefängnis ganz entflieht, auf der Suche nach den grünen Hügeln und Bambuswäldern ihrer Jugend, dann verliert Kaguya, und mit ihr die Welt, vollends ihre Konturen, für ein paar magische Minuten fliegen nur noch lose aneinandergebundene Farbflecken durch einen vollends entgrenzten Bildraum.
Gemeinsamer Flug durch die Wolken
Doch bald kehren die klaren, gerade Linien zurück. Das ländliche Paradies ist auf immer verloren – das zeigt besonders eindrücklich eine letzte Begegnung mit der Jugendliebe Sutemaru. Ihr gemeinsamer Flug durch die Wolken ist eine bloße nostalgische Fantasie. Der Film hat anderes vor mit Kaguya.
Sie muss sich der Versuche ihres Vaters erwehren, sie zu verheiraten; und ganz am Ende meldet eine weitere, eine himmlische Ordnung Ansprüche an sie an, eine Ordnung, die endgültig keine deformierte Linie, keine über die Linie hinausschießende Farbe mehr zulässt, die schließlich den Film selbst auslöscht und nichts zurücklässt als Tränen.