Diskussion um Wehrdienst: Doppelte Solidarität
Alle jungen Frauen und Männer sollten ein soziales Jahr leisten. Und alle sollten danach einen Anteil am Erbvermögen erhalten.

B undesverteidigungsminister Boris Pistorius will einen freiwilligen Wehrdienst. Die Union will eine Wehrpflicht, aber nur für Männer. Beiden geht es dabei „nur“ um die Bundeswehr. Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) will immerhin ein soziales Jahr, für Ältere, Bodo Ramelow eines für alle junge Leute. Was all diesen Forderungen abgeht, ist ein Gesamtkonzept, das über die Verteidigungsfähigkeit hinaus vor allem den Zusammenhalt der Gesellschaft stärkt – und dabei alle Generationen einbindet.
Es wird deshalb Zeit, zwei Ideen zusammenzudenken, die bisher nicht zusammengedacht werden: die Forderung nach einem verpflichtenden Gesellschaftsjahr für alle Frauen und Männer ab 18 Jahren – und die Idee eines Grunderbes für alle jungen Menschen. Daraus könnte ein neuer Generationenvertrag entstehen. Klar, Worte wie „Pflichtjahr“ scheinen nicht in eine Gesellschaft zu passen, die sich immer stärker der individuellen Freiheit verpflichtet fühlt.
Viele sprechen sich lieber für eine Stärkung des Freiwilligendienstes aus. Damit es keine Missverständnisse gibt: Ein freiwilliges Engagement junger Menschen ist eine tolle Sache. Doch: Nur 7 Prozent entscheiden sich jedes Jahr dafür, mehr als 93 Prozent erreicht das Angebot also nicht. Der gesellschaftliche Zusammenhalt wird so nicht gestärkt.
ist Ökonom und Publizist. Er war von 1999 bis 2019 Chefredakteur der Zeitschrift Publik-Forum. Von ihm erschien 2023 das Buch „Das Ende des billigen Wohlstands. Wege zu einer Wirtschaft, die nicht zerstört“, Publik-Forum Verlag 2023.
Wie wichtig jedoch genau dies wäre, zeigt ein Blick auf die Lage junger Menschen. Mehr als drei Millionen Kinder und Jugendliche wachsen laut Paritätischem Wohlfahrtsverband in prekären Verhältnissen auf, manche schon in zweiter oder dritter Generation. Die Selektion an den Schulen verstärkt die soziale Spaltung. An Gymnasien und Realschulen sind die Kinder in erster Linie mit jenen zusammen, die aus ihrem Herkunftsmilieu kommen. An den Hochschulen setzt sich dieses Aussortieren fort.
Nicht als Ersatz für Fachkräfte
Entsprechend bewegen sich junge Menschen in völlig unterschiedlichen Lebenswelten. Ein Trend, der längst auch Erwachsene erreicht hat. „In unserem Land mangelt es an Begegnung und Austausch zwischen den Verschiedenen“, sagt Bundespräsident Frank Walter Steinmeier, „zwischen Jungen und Alten, Armen und Reichen, Ost- und Westdeutschen, zwischen Städtern und Landbewohnern, zwischen hier Geborenen und Zugewanderten.“ Steinmeier wirbt seit Langem für „ein soziales Pflichtjahr“.
Wenn es gelänge, alle jungen Menschen, die nicht schwer beeinträchtigt sind, für ein Jahr zu gesellschaftlichem Engagement zu verpflichten und ihnen danach ein Startkapital für ihr Leben zu gewähren, das von der älteren Generation finanziert wird, wäre dies ein erheblicher Beitrag zu einer gerechteren und solidarischeren Gesellschaft.
Wie könnte das konkret aussehen? Alle Beteiligten sollen frei darüber entscheiden können, wo sie ihr Dienstjahr ableisten: bei der Bundeswehr, in sozialen Institutionen, in Sportvereinen, im Umweltbereich, im Entwicklungs- oder Friedensdienst. Sie erhalten dafür nur einen bescheidenen Lohn, wie ehedem für Wehr- und Zivildienst. Dabei darf das Gesellschaftsjahr nicht zu einer billigen Ersatzlösung werden, um den Arbeitskräftemangel in der Pflege, in Kitas, Schulen und anderen Bereichen zu kaschieren.
Andererseits brauchen Kitas, Krankenhäuser, Pflege im Haus und in Heimen in jeder Hinsicht Unterstützung. Aber nicht nur dort gibt es viel zu tun: Wer hilft, kommunale Gärten oder Parks naturgerecht anzulegen oder Wälder aufzuforsten? Wer verstärkt die Feuerwehr, wer unterstützt die unzähligen Vereine, wer den Sport? Unabhängig von der gewohnten Umgebung und vom Konkurrenzkampf um Karrierechancen könnte das Gesellschaftsjahr jungen Leuten neue Perspektiven eröffnen.
Leistung und Lohn
Alle müssen sich mit den Lebenswelten der anderen auseinandersetzen. Junge Frauen und Männer aus Gymnasien treffen auf Hauptschülerinnen und Hauptschüler, Christen auf Muslime und Juden. Natürlich kann dies auch Konflikte auslösen. Doch vielfach würde die positive Wirkung überwiegen. Junge Leute würden Selbstwirksamkeit erleben, die ihnen in schwierigen Situationen hilft, nicht in Resignation, Depression oder Aggression abzugleiten.
Aber das Gesellschaftsjahr für junge Leute ist nur eine Seite der Medaille. Es geht auch darum, die ältere Generation in die Solidarität einzubinden. Zum Beispiel, indem junge Leute nach dem sozialen Jahr mit einem Anteil aus dem Reichtum der Älteren belohnt werden. Jährlich werden 400 Milliarden Euro vererbt, doch viele junge Leute erben nichts. Wie sich dies ändern ließe, zeigt ein Vorschlag des DIW in Berlin. Danach sollen alle jungen Erwachsenen ab 18 Jahren ein Grunderbe von 20.000 Euro erhalten.

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.
Finanziert werden soll das durch die Abschaffung von Privilegien für Multimillionäre in der Erbschaftsteuer, einem höheren Spitzensteuersatz oder einer Besteuerung hoher Vermögen, erklärt der Ökonom Stefan Bach. Rund 15 Milliarden Euro könnten auf diese Weise zusammenkommen. Für Bach wäre das ein großer Schritt zu einer gerechteren Gesellschaft: „Mit einem jährlichen Erbe für alle jungen Erwachsenen würde sich die Konzentration des Reichtums in den Händen des reichsten Prozents in 30 Jahren halbieren, während der Anteil der unteren Hälfte der Bevölkerung am Gesamtvermögen langsam steigt.“
Wie wäre es also mit einer Art doppelter Solidarität? Alle jungen Menschen leisten ein Gesellschaftsjahr und erhalten danach einen Anteil am Erbvermögen in Höhe von 20.000 Euro – als Startkapital für ihr Leben. Mehr Solidarität in der Gesellschaft ist dringend notwendig, wenn die kommenden Umwälzungen demokratisch und friedlich bewältigt werden sollen. Dass die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts bei der Debatte über die Wehrpflicht kaum eine Rolle spielt, ist eine vergebene Chance.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






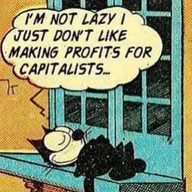

meistkommentiert
Linken-Bashing in der „Zeit“
Vom bürgerlichen Drang, über Mitte und Norm zu herrschen
Buch über Erfolg der Nazi-Ideologie
Die Lust am Hass bleibt
Prozess gegen Flüchtlingshelfer
Hilfe als Straftat?
Historikerin über rechte Körperpolitik
Die Fantasie vom schönen Volk
Die Grünen und das Verbrenner-Aus
Peinliches Manöver, aber Kurve gekriegt
Problem Holzkohle
Grillgenuss ohne Waldverlust