Abhängigkeit von US-Diensten: Europas Antwort auf Paypal
Der europäische Bezahldienst Wero soll eine Alternative zu Paypal bieten. Es ist nicht der einzige Ansatz, der für mehr Unabhängigkeit sorgen soll.

Das schafft Abhängigkeiten und sorgt damit für Kritik – spätestens seitdem im August eine größere Störung bei mehreren Hunderttausend Nutzer:innen in Deutschland zu Problemen führte. Was, wenn Trump das Funktionieren von US-Diensten in Europa als Druckmittel einsetzt, etwa im Handelsstreit?
Sascha Straub, Verbraucherzentrale Bayern
„Wir haben momentan einen Zahlungsmarkt, der extrem abhängig ist von US-Anbietern“, sagt Sascha Straub, Experte für Finanzdienstleistungen bei der Verbraucherzentrale Bayern. „Natürlich soll das Bezahlen aus Konsumentensicht einfach, sicher und schnell sein.“ Aber darüber hinaus sei auch wichtig, die Souveränität Europas im Zahlungsverkehr mitzudenken.
Diese Ausgangslage könnte einem potenziellen neuen Konkurrenten zugutekommen: Wero. Für ihn haben sich ein gutes Dutzend europäischer Finanzinstitute zu einer Allianz zusammengeschlossen, der European Payments Initiative (EPI), die mit Wero eine europäische Alternative zu Paypal schaffen soll. Gestartet ist der Dienst im vergangenen Jahr.
Bislang ist er allerdings nur in Frankreich, Belgien und Deutschland nutzbar, nur von Privatperson zu Privatperson und noch nicht im Handel. Doch das soll noch kommen: „In Kürze“, so die EPI, sollten geschäftliche Zahlungen möglich sein, online und vor Ort.
Millionen potenzielle Nutzer:innen
Wenn es so weit ist, können auf einen Schlag Millionen Nutzer:innen Wero verwenden: In Deutschland sind unter anderem die Sparkassen und Volksbanken dabei, die GLS- und die Postbank. Erst im August hat sich die Direktbank ING an Wero angeschlossen. Damit sind alleine in Deutschland rund 10 Millionen potenzielle Nutzer:innen dazugekommen.
Wero ist nicht der einzige Ansatz, um Europa etwas unabhängiger zu machen von US-amerikanischen Finanzdienstleistern. Dazu zählt nicht nur Paypal, sondern auch Apple Pay, Google Pay und die Branchenriesen Visa und Mastercard. Die erste Neuerung: Ab dem 9. Oktober müssen Banken, zunächst im Euroraum, Echtzeitüberweisungen anbieten, und zwar kostenlos. Bislang kann es mehrere Tage dauern, bis überwiesenes Geld beim Zielkonto gutgeschrieben ist. Wer es schneller braucht, muss draufzahlen.
Digitaler Euro
Und dann ist da noch der digitale Euro. Der soll der Idee nach so etwas sein wie digitales Bargeld. Also: niedrigschwellig, grenzübergreifend im Euroraum einsetzbar. Auch Anonymität wird immer wieder als Merkmal genannt, auch wenn lange noch nicht raus ist, ob dieses Versprechen wirklich eingelöst wird. Doch bis es so weit ist, wird es noch eine Weile dauern: Piero Cipollone, Direktor der Europäischen Zentralbank (EZB), sagte im September, 2029 wäre ein realistisches Datum für die Einführung des digitalen Euro.
Nicht alle sehen diese Gleichzeitigkeit positiv. Stefan Reuß, Geschäftsführender Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen, kritisierte laut Redemanuskript kürzlich bei der Vorstellung der Halbjahresgeschäftszahlen: „Die Pläne für einen digitalen Euro für Privatkunden behindern jedoch diesen flächendeckenden Ausbau von Wero kolossal, weil in Europa manche Banken keine Parallelstrukturen aufbauen möchten und deshalb abwarten.“
Viele Wege, viele Möglichkeiten
Diese Haltung kritisiert wiederum Verbraucherschützer Straub. Der digitale Euro habe neben Wero sehr wohl eine Berechtigung: Zum einen, weil längst nicht sämtliche Banken an Wero angebunden sind und unklar ist, ob das eines Tages der Fall sein wird. Beim digitalen Euro wären alle Institute automatisch dabei. Zum anderen, weil der digitale Euro, wie Bargeld, gesetzliches Zahlungsmittel sein soll. Er würde also auch im Handel direkt eingesetzt und müsse für alle Menschen niedrigschwellig zugänglich sein.
Womöglich werden daher eines Tages all diese Wege ihre Berechtigung haben. Denn leicht zugänglich ist Wero derzeit nicht unbedingt: Für die Nutzung ist ein Smartphone mit der Banking-App des Instituts nötig, bei dem das eigene Girokonto liegt. Bei einem Teil der Banken lässt sich auch die Wero-App selbst verwenden. Eine Desktop-Version, um Wero auf dem Computer im Browser zu benutzen, gibt es aber nicht. Und wer Banking vom Smartphone fern halten will oder wessen Gerät zu alt ist, ist raus.
Darüber hinaus ist bei mindestens einem Teil der Apps ein Zugriff auf die Kontakte im Telefonbuch nötig. Damit wird abgeglichen, welche der eigenen Kontakte Zahlungen über Wero empfangen oder senden können. Zwar reicht laut den Erläuterungen der EPI eigentlich auch eine E-Mail-Adresse.
Das wäre ein Vorteil, weil sich eine E-Mail-Adresse einfacher wechseln lässt, wenn man sie etwa auf einem Kleinanzeigenportal angegeben hat und später von Spam überrollt wird. Doch nicht jede Bank setzt diese Option um: So ist laut ING die Angabe der Mobilfunknummer und der Zugriff auf die Kontakte nötig.
Dazu kommt: Ob Wero tatsächlich funktionieren würde, wenn Trump das Europageschäft von US-Diensten unterbinden würde, ist unklar. Zumindest was den Betrieb der Webseite angeht, setzt Wero nach Informationen der taz teilweise auf Dienstleister, die US-Recht unterstehen, auch wenn die konkreten Server in der EU stehen sollen. Die Frage, wie das bei Diensten aussieht, die für das Funktionieren von Wero notwendig sind, ließ die EPI trotz wiederholter Anfrage unbeantwortet.
Verbraucherschützer Straub hofft: „Je mehr unterschiedliche Systeme wir in Europa haben, desto eher ist für jeden was dabei.“ Im nächsten Schritt müsse Wero nun schnell in den Handel kommen. Denn solange man darüber nur Geld an andere Privatpersonen schicken könne, werde sich wohl kaum ein:e Nutzer:in zum Umstieg bewegen lassen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






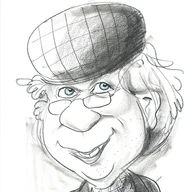
meistkommentiert