
Erinnerungskultur am 9. November: Wie geht Gedenken heute?
Die Erinnerung an den Holocaust droht zu verblassen. Wie KZ-Gedenkstätten das mithilfe von TikTok, neuen Perspektiven und Workshops verhindern wollen.
D aniel Molchanov steht vor 22 Schülerinnen und Schülern. „Wann wurde das erste KZ in Deutschland eröffnet?“, fragt der Guide die Jugendlichen, bevor er sie über das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Sachsenhausen führt. „1920“, sagt ein Schüler, „1939“ vermutet eine Mitschülerin. „Das war im März 1933 in Oranienburg“, stellt Molchanov klar. Ein Jahr später wurde es geschlossen, 1936 entstand dann am Ortsrand das KZ Sachsenhausen. „Was machte man im KZ?“, will Molchanov weiter wissen. „Arbeiten“, antwortet ein Schüler. „Es war Zwangsarbeit“, präzisiert der Guide, „unter mörderischen, oft tödlichen Bedingungen.“
Vier zehnte Klassen einer weiterführenden Schule aus einer brandenburgischen Kleinstadt sind an diesem Vormittag mit dem Bus angereist. Die Namen der etwa 15-Jährigen bleiben anonym wie auch der Schulort. So ist es mit der Direktorin vereinbart. Es ist Ende September, das Wetter ungemütlich, immerhin regnet es nicht. An dieser Schule ist der Besuch der Gedenkstätte Sachsenhausen Teil des Fachs Politische Bildung und damit verpflichtend. Pro Klasse steht ein Guide bereit.
Wie vermittelt man Jugendlichen, die nicht viel mehr wissen, als dass Hitler und seine Gefolgsleute Verbrecher waren, etwas von der Perfidie und Grausamkeit eines komplexen Lagersystems, das Andersdenkende, Andersaussehende, Andersliebende, Andersglaubende als „unwertes Leben“ kategorisierte Menschen einsperrte, quälte, umbrachte?
Guide Daniel Molchanov zeigt ihnen, was nach der Ankunft im Lager passierte: die Ausgabe von Häftlingskleidung und -nummer; er erklärt die interne Hierarchie anhand der verschiedenfarbigen Winkel, je nach politischer, religiöser, nationaler, sozialer oder rassifizierender Zuschreibung. Zwei Stunden dauert seine Führung, die ausgewählte Stationen ansteuert: die Station Z mit Gaskammer und Krematorium, die als Messlatte getarnte Genickschussanlage, Krankenrevier, Bordell. Molchanov weist auf die von Neonazis im Jahr 1992 in Brand gesteckte Baracke jüdischer Häftlinge, die als Mahnzeichen stehenblieb.
Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.
Wie bei den KZ Dachau oder Auschwitz steht in Sachsenhausen der Schriftzug „Arbeit macht frei“ im schmiedeeisernen Torgatter, das Zutritt zum ehemaligen Häftlingslager gewährt. Nur zwei der Originalbaracken aus Holz sowie zwei weitere teilrekonstruierte sind erhalten geblieben, einige Wirtschaftsgebäude, Wachtürme und die Lagermauer. Das eigentliche KZ-Gelände wirkt karg, fast kahl. Außerhalb waren die Kommandantur mit kleinem Privatzoo, das SS-Truppenlager und die „Inspektion der Konzentrationslager“ untergebracht. Wer die 20 Minuten vom Bahnhof zur Gedenkstätte läuft, kommt vorher an kleinen Einfamilienhäusern vorbei, in denen die SS-Offiziere des Kommandanturstabes und der KZ-Inspektion mit ihren Familien wohnten.
Sachsenhausen war kein Massenvernichtungslager wie Auschwitz oder Treblinka. Als KZ nahe Berlin, das als erstes vollständig neu errichtet wurde, hatte es Modellcharakter. Von hier aus gründete die SS neue Konzentrationslager, probierte, was aus menschlicher Arbeitskraft rauszuholen war, feilte am Lagersystem. Mehr als 200.000 Menschen waren in den Jahren 1936 bis 1945 in Sachsenhausen inhaftiert. Sie wurden ermordet, misshandelt, versklavt, für medizinische Experimente missbraucht, zu Sexarbeit gezwungen, von hier in die Vernichtungslager deportiert. Zehntausende starben in Sachsenhausen.
Lässt sich 80 Jahre nach Ende des Nationalsozialismus Heranwachsenden noch vermitteln, was hier Ungeheuerliches geschehen ist? Wo knüpft man an, was für neue Formate braucht es, die sich jenseits der bekannten ikonografischen Bilder und Narrative bewegen? Es gibt fast keine Zeitzeugen oder -zeuginnen mehr, die in Schulen von ihrem Schicksal berichten können. Ist das ein Bruch in der deutschen Gedenkkultur? Muss sie sich anders, neu aufstellen?

„Noch während meines Studiums wurde uns als gesichertes Wissen vermittelt, dass mit dem Ende der Zeitzeugenschaft das Interesse am Nationalsozialismus stirbt“, sagt Axel Drecoll, der seit 2018 die Gedenkstätte Sachsenhausen leitet. „Das Gegenteil ist richtig.“ Der Historiker, Jahrgang 1974, empfängt in seinem Büro, das in der ehemaligen „Inspektion der Konzentrationslager“ untergebracht ist. Heute befindet sich in dem Verwaltungsbau neben der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten auch das Oranienburger Finanzamt.
Axel Drecoll, Historiker und Leiter der Gedenkstätte Sachsenhausen
Wider Erwarten sei „ein neues Interesse an der NS-Geschichte“ zu bemerken, sagt Axel Drecoll, was damit zu tun haben könnte, dass die dritte und vierte Generation sich unbefangener der Vergangenheit nähern kann. In der praktischen Arbeit der Gedenkstätte aber sei ein Großteil der Gäste ohnehin nie mit Zeitzeug:innen in Berührung gekommen. „Die Gedenkstätte hat in den vergangenen Jahrzehnten große Anstrengungen unternommen, die Erfahrungen der Überlebenden mit musealen Mitteln wie Zeitzeugeninterviews und biografischen Darstellungen lebendig zu halten.“
Vor drei Jahren beschloss die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, zu der neben Sachsenhausen auch das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück gehört, eine umfassende Modernisierung der Gedenkstätte und die Überarbeitung der Dauerausstellung. Sie wird als nicht mehr zeitgemäß empfunden. Das ist neuen Ansätzen bei der Aufarbeitung der NS-Zeit geschuldet, aber auch den Möglichkeiten der Digitalisierung und nicht zuletzt den drängenden politischen Problemen unserer Zeit. „Bei rechtsextremen Narrativen sind wir gefragt, um kritisches Nachdenken anzuregen“, sagt Gedenkstättenleiter Axel Drecoll. „Kuratorisch sollten wir mehr Gegenwartsbezug herstellen. Damit retten wir die Demokratie nicht, aber wir können ein lautes und vernehmliches Nein von uns geben.“
KZ-Gedenkstätten als Orte der Gewalt, der Willkür, des Todes, kommt in der Aufarbeitung eine besondere Bedeutung zu. Sie bewahren die Erinnerung, dokumentieren die Verbrechen, helfen zu kontextualisieren. Sie sind zugleich Orte der Begegnung, des Austauschs, auch der internationalen Forschung, geben Überlebenden und ihren Nachfahren die Möglichkeit zu trauern. Und den Regierenden die Möglichkeit, bei offiziellen Anlässen und Gedenktagen Kränze niederzulegen. Ob sie mit dem Herzen dabei sind, weiß man nicht.
„Wir dürfen nicht vergessen, dass zu den Gedenkveranstaltungen nach wie vor Angehörige kommen“, sagt Axel Drecoll, der bei diesen Anlässen Reden halten muss. „Gedenken ist Ritual, das lebt vom Ritus, von der Wiederkehr. Ich erlebe das nicht als erstarrt, sondern als etwas sehr Lebendiges.“
Verbockte Entnazifizierung
Es hat bis in die 1980er Jahre hinein gedauert, dass Gedenkfeiern zur Staatssache wurden. Die Nachkriegsgesellschaft der BRD verbockte die Entnazifizierung, verschleppte die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, entzog sich dem offiziellen Gedenken. Es waren die Überlebenden und Angehörigen der Ermordeten, die in ehemaligen KZ für erste Mahnmale und Ausstellungen sorgten. Erst in den 1990er Jahren wurden aus Gedenkstätten auch Dokumentationszentren und Forschungsstätten.
Mit der deutschen Einheit stellte sich die Frage, was mit den ehemaligen Konzentrationslagern auf DDR-Gebiet geschehen sollte, die zwischen 1945 und 1950 zu sowjetischen Speziallagern wurden. Buchenwald und Sachsenhausen zählen zu diesen Einrichtungen mit einer doppelten Gewaltgeschichte. Ab Ende der 1950er Jahre wurden sie zu nationalen Mahn- und Gedenkstätten erklärt, die vorrangig den kommunistischen Widerstand würdigten. Jüdisches Leid wurde ignoriert. In der Bundesrepublik wurde 1999 vom Bund ein offizielles Gedenkstättenkonzept beschlossen, das 2008 erneuert wurde und das Erinnern an die Opfer des Stalinismus und der SED-Diktatur mitumfasst.
Beim derzeitigen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (CDU) ist nun ein neues Konzept in Arbeit. Weimer hat angekündigt, dass er die Idee seiner Amtsvorgängerin Claudia Roth (Grüne), den deutschen Kolonialismus und die Geschichte der Einwanderungsgesellschaft inhaltlich in eine Neukonzeption einzubeziehen, ablehnt. Roths Vorschlag hatte für Aufregung gesorgt, in der Politik, in den Feuilletons, in den Gedenkstätten: Stellt man damit nicht die Präzedenzlosigkeit des Holocaust in Frage? Oder sollte man gerade historische Kontinuitäten und Brüche herausarbeiten? Roths Konzept fiel durch, wurde überarbeitet und nach dem Bruch der Ampelkoalition nicht mehr verabschiedet.
„Der Kolonialismus ist ein Verbrechen gewesen, das dringend mehr Aufmerksamkeit braucht“, sagt Axel Drecoll dazu. „Nur ist es ein Thema eigenen Rechts. Es hat andere Voraussetzungen als die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Diktatur.“ Dazu gehöre, dass es kaum Tatorte in Deutschland gebe, das verbrecherische System nicht von einer Diktatur im Inland ausgeübt worden sei und zeitlich bis ins preußische Königreich zurückreiche. „Man muss mit Nachdruck dafür Sorge tragen, dass der Kolonialismus aufgearbeitet wird. Wenn es dafür ein eigenes Konzept gibt, fände ich das sinnvoll.“
Die Konzeption aus dem Hause Weimer, so viel weiß man schon, spricht sich für den Erhalt der historischen Orte, einen Ausbau der Digitalisierung und des pädagogischen Bereichs aus. Eine Kabinettsbefassung im November sei „angestrebt“, lässt seine Pressestelle mitteilen.
52 „Vorfälle“ und knappe Ressourcen
Die 1961 am Ort des ehemaligen KZ Sachsenhausen eröffnete Gedenkstätte (damals DDR) gehört seit 1993 zur Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, die halb vom Bund und halb vom Land Brandenburg finanziert wird. „Ich will nicht verhehlen, dass wir in einer Zeit der politischen Verunsicherung und knappen Ressourcen leben“, sagt Stiftungsdirektor Axel Drecoll. Durch die Zunahme von Rechtsextremismus, Geschichtsrevisionismus und Antisemitismus seien für die Gedenkstätten finanzielle und personelle Ressourcen erforderlich, mit denen sie adäquat auf die neuen Herausforderungen reagieren können.
52 „Vorfälle“ wurden laut Pressestelle 2024 in der Gedenkstätte Sachsenhausen und Umfeld registriert. Dazu gehören Karten, die die Besucher:innen nicht mit ihrem Feedback, sondern mit antisemitischen, israelfeindlichen oder rechtsextremen Inhalten beschrieben haben. Außerdem: Sachbeschädigung, rassistische Beleidigungen, Propagandadelikte, Schmäh- und Hassmails. Im Jahr davor waren es 21 „Vorfälle“ weniger. Selten lässt sich verfolgen, wer dahintersteckt. Das Gästebuch einer Sonderausstellung wurde deswegen 2024 aus dem Verkehr gezogen. Für 2025 sind 32 „Vorfälle“ registriert worden. Stand: Anfang Oktober.
Vertreter*innen der AfD werden von der brandenburgischen Stiftung nicht zu Gedenkveranstaltungen eingeladen.
„Angriffe und Pöbeleien treffen nicht alle Gedenkstätten gleichermaßen“, sagt Drecolls Kollege Oliver von Wrochem, Leiter der KZ-Gedenkstätte Neuengamme bei Hamburg. Auch in Neuengamme verzeichnet man seit zwei Jahren verstärkt israelfeindliche und antisemitische Schmierereien sowie Äußerungen, die vor allem als Einträge in den Besucherbüchern zu finden waren. Diese ließen sich nicht eindeutig einer bestimmten Gruppe zuordnen. Dennoch blieben die rechtsextremen oder neonazistischen Vorfälle dominant, sagt von Wrochem.
Der Historiker ist Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der KZ-Gedenkstätten. „Erschreckend ist das Ausmaß an Übergriffen und Schmierereien vor allem in Ostdeutschland“, sagt er. Besonders betroffen ist die Gedenkstätte Buchenwald in Thüringen, wo die AfD bei der Landtagswahl stärkste Kraft wurde. Doch seit der Pandemie sind laut von Wrochem auch westdeutsche Gedenkstätten verstärkt betroffen. Eine gemeinsame Kriminalstatistik gibt es nicht.
Wäre es unter diesen Umständen nicht eine gute Idee, Pflichtbesuche für Schulen in KZ-Gedenkstätten zu fordern? Axel Drecoll von der Gedenkstätte Sachsenhausen ist skeptisch. „Zum einen könnten wir eine intensive pädagogische Betreuung personell wie strukturell gar nicht leisten, zum anderen finde ich, dass Zwang eine schlechte Überschrift für eine freiheitliche Form der Geschichtsvermittlung ist.“
Innovative Konzepte haben sie in Sachsenhausen viele in der Schublade. Vor allem Mitmachformate kommen gut an, gerade bei jungen Leuten. Wie der musikpädagogische Workshop „Musik macht Geschichte“, in dem sich unter anderem mit Liedern beschäftigt wird, die im KZ entstanden sind. Oder Digitales wie der Tiktok-Kanal oder die App „Den Dingen auf der Spur“, die die Gedenkstätte Sachsenhausen gemeinsam mit Buchenwald konzipiert hat. Erkundet werden können darin einzelne Objekte: Ein Holzschuh, eine Armbinde, eine Häftlingsmarke, die etwas über den Alltag im Lager verraten und die Schüler:innen so spielerisch auf den Besuch der Gedenkstätte vorbereiten.
Das Problem ist, dass gerade die innovativen und digitalen Formate meist drittmittelfinanziert und auf drei Jahre begrenzt sind, berichten die Mitarbeiter:innen aus der pädagogischen Abteilung. So gelingt die Neuausrichtung einer großen Institution wie der Gedenkstätte nur sehr langsam. 43 festangestellte Mitarbeiter:innen arbeiten in Sachsenhausen, viele davon nur in Teilzeit oder auf limitierten Projektstellen. Hinzu kommen die vielen Freien wie Daniel Molchanov.
Und es gibt hohe Kosten. Allein der Erhalt der Bausubstanz verschlingt viel Geld und verlangt weitere Investitionen. 60 historische Bauwerke verteilen sich auf dem Gelände. Aber auch die Personal-, Dienstleistungs- und Energiekosten sind enorm gestiegen. „Ohne dass unsere Infrastrukturprobleme gelöst werden, können wir die Antworten, die wir in Bezug auf die Gegenwart und Zukunft vielleicht schon haben, nicht umsetzen“, sagt Axel Drecoll.
Der Gedenkstättenleiter sieht gerade im Bereich des Digitalen große Chancen, junge Leute zu erreichen und mit ihnen zu interagieren. „Wir wollen die Korrespondenz von virtuellem Raum und topografischem Ort stärken“, erklärt er. „Wir haben zum Beispiel einen Medientisch in der Ausstellung zur Geschichte der KZ-Inspektion, die mit großem bürokratischen Aufwand das KZ-System steuerte. Dort kann ich mir Fallakten angucken, die Täterhandeln beschreiben, und ich kann Signaturen entschlüsseln.“ So ließe sich ein sprödes Dokument spannend analysieren: Was steckt hinter der grünen Unterschrift und was hinter dem kleinen Kreuz eines sogenannten „Euthanasiearztes“? „Man kann das selbst erforschen“, sagt Drecoll fast enthusiastisch. „So lernt man: Spurenlesen.“
Ein Dokument zeigt etwa, dass die Bestrafung eines Häftlings in der KZ-Inspektion beantragt werden musste, durch zahlreiche Hände ging und mit Unterschriften versehen wurde, bis am Schluss ein SS-Arzt bestätigte, dass die angeordneten 25 oder 50 Stockschläge ordnungsgemäß erteilt wurden.
493.000 Menschen haben die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen im vergangenen Jahr besucht, davon kamen etwa 32 Prozent aus dem Ausland. An diesem Herbsttag wandern deutsche Schulklassen sowie japanische, italienische und spanische Touristengruppen über das Gelände. Es gibt nicht eine große Ausstellung, sondern 13 dezentral angeordnete Einzelausstellungen, die bei den jeweiligen Stationen angedockt sind.
In zwei Stunden ist das nicht zu schaffen. Daniel Molchanov steht mit seiner Schulgruppe auf dem einstigen Appellplatz und zieht ein historisches Foto aus seinem Jutebeutel. Darauf zu sehen sind endlose Reihen von Häftlingen in Sträflingskleidung beim Appell. Es liegt Schnee, sie tragen Stiefel, Wintermäntel. Vom Wachturm, aus der Zentralperspektive aufgenommen, suggeriert das Foto Macht, Überwachung, Ordnung, aber auch Ordentlichkeit. Ob den Schüler:innen etwas auffalle?
„Ein Propagandafoto“, erklärt Molchanov. Dieser Punkt ist ihm wichtig. Die meisten Fotos, die das Leben im KZ dokumentieren, stammten von SS-Leuten, seien aus Täterperspektive aufgenommen. Sie beschönigen oder sie erniedrigen bewusst. Wintermäntel hätten die Lagerinsassen keine besessen. Molchanov hält eine Zeichnung hoch, die abgemagerte, zerlumpte Gestalten vor einer Barackenwand zeigt. Ein Häftling hat sie angefertigt.
Die Bilddokumentation ist in den letzten Jahren in den Fokus der Ausstellungsmachenden geraten. Schließlich haben bestimmte Bildnarrative unser kollektives Bewusstsein tief geprägt: Das Lagertor von Auschwitz, die halbtoten Menschen bei der Befreiung der Lager, das Zusammentreiben von Gruppen im Ghetto wie Vieh, die Massengräber. Ging es lange Zeit darum, die Gräueltaten der Nationalsozialisten zu dokumentieren, ist man heute dazu übergegangen, mit weniger Bildern und anderen Quellen zu arbeiten. Häftlinge besaßen keinen Fotoapparat, an Stift und Papier zu gelangen, war schwer. Trotzdem gibt es sie: die Lieder oder Gedichte aus den Lagern.
Margitta Steinbach, Sintiza und Gründerin des Vereins Menda Yek
Wer aber hat das Recht an den Aufnahmen? Wer darf die Propagandabilder der NS-Leute zeigen und was lösen sie bei Angehörigen oder Nachfahren aus?
Bei Margitta Steinbach waren es: Bestürzung, Schock, Wut, Trauer. Die 50-jährige Sintiza aus Berlin erzählt, wie sie sich vor ein paar Jahren das erste Mal in einer Ausstellung in Halle zum Schicksal der mitteldeutschen Sinti und Roma dem Bild einer Tante gegenübersah, die sie großgezogen hatte. Sie begann zu recherchieren, sich zu engagieren, gründete den Verein Menda Yek, der die Geschichte ihrer Vorfahren aufarbeitet.
„Wie waren die Ausstellungsmacher an diese Fotos gekommen“, habe sie sich gefragt, erzählt Steinbach. „Wie kann das sein, dass mir nicht bekannte Menschen im Namen der Wissenschaft Zugriff auf unsere Daten oder Bilder haben, ohne dass wir davon wissen? Unsere Familien haben nie etwas zurückbekommen. Wir besitzen keine Fotos unserer Angehörigen, die im Nationalsozialismus ermordet wurden.“
Hinterbliebene überarbeiten Ausstellung
Erst 1982 erkannte die Bundesrepublik Sinti und Roma als Verfolgte des NS-Regimes an. Etwa 500.000 Menschen, von den Nationalsozialisten als „Zigeuner“ bezeichnet, wurden ermordet. Im KZ trugen sie einen schwarzen Winkel. Finanzielle Entschädigung und moralische Wiedergutmachung mussten sich ihre Hinterbliebenen hart erkämpfen, die gesellschaftliche Ausgrenzung und amtliche Diskriminierung hielt nach 1945 an.

Als 2004 die Ausstellung „Sinti und Roma im Konzentrationslager Sachsenhausen“ eröffnet wurde, war dies die erste große Ausstellung in einer deutschen KZ-Gedenkstätte. Sie richtete ihr Augenmerk auf die Praktiken der „Rassenhygienischen und kriminalbiologischen Forschungsstelle“ (RHF), die zwischen 1938 und 1945 auch in Sachsenhausen ihre pseudoanthropologischen Forschungen an Sinti und Roma betrieb. Es sind drastische Ausstellungsstücke, darunter Polizeifotos, Haarbestimmungstafeln, Vermessungsdaten und Gesichtsabdrücke, die man den Verfolgten unter Zwang abnahm.
Und es sind Objekte mit einer besonderen Geschichte. Sie befanden sich jahrzehntelang im Archiv der Universität Tübingen, weil eine Wissenschaftlerin des RHF ihre Karriere dort nach Kriegsende ungehindert fortsetzen konnte. Erst die Besetzung des Archivs im Jahr 1981, organisiert von der Bürgerrechtsbewegung unter Romani Rose, erzwang die Überführung der „NS-Rasseakten“ ins Bundesarchiv.
An einem Freitag im Oktober treffen wir Margitta Steinbach vor dem Eingang zu einer der zwei Holzbaracken, wo groß und mit gelber Schrift ein Plakat verkündet: „Wir intervenieren: Kritische Perspektiven auf die Ausstellung Sinti und Roma im Konzentrationslager Sachsenhausen.“ Die Intervention ist Teil der Dauerausstellung zum Themenkomplex „Medizin und Verbrechen“ im ehemaligen Krankenrevier. Steinbach hat an der Intervention mitgewirkt. Auch Mareike Otters und Katja Anders, Mitarbeiterinnen der Gedenkstätte, sind vor Ort, da am Nachmittag eine Führung durch die Ausstellung stattfindet. Die Frauen umarmen sich, der Kontakt ist herzlich.
Otters und Anders haben in der Gedenkstätte die Intervention mit initiiert. Otters ist Historikerin, Anders Erziehungswissenschaftlerin, sie arbeiten in der Ausstellungs- beziehungsweise Pädagogikabteilung. „Wir spürten das Bedürfnis nach einer anderen kuratorischen Praxis“, sagen sie. Zu dieser neuen kuratorischen Praxis gehört, dass in Zusammenarbeit mit dem „Bildungsforum gegen Antiziganismus“ Workshops stattfanden, in denen Wissenschaftler:innen sich mit Aktivist:innen zusammengesetzt haben und die Ausstellung auf ihre Sprache, ihre Exponate und auf das, was nach 1945 geschah, abgeklopft haben.
2004, als die Ursprungsausstellung entstand, ging es der Gedenkstätte darum, Öffentlichkeit herzustellen, Präsenz zu zeigen. Doch jede Ausstellung kommt in die Jahre, auch diese. „Heute gibt es neue Erkenntnisse und Ansätze der Vermittlung“, sagt Margitta Steinbach. Die Auseinandersetzung mit belasteten Begriffen ist intensiver, sensibler geworden.
Das „Z-Wort“ taucht überraschend oft auf und ist deswegen mit gelben Streifen überklebt. „Muss man es so oft benutzen?“, fragt Steinbach, während wir durch die Gänge laufen. Neue Bild-Text-Tafeln liefern historische Kontextualisierung, verfolgen die Karrieren der NS-Täter:innen, beschreiben die prekäre wirtschaftliche Situation der Überlebenden nach dem Krieg. Mit einem Teil der Fotos hat Steinbach nach wie vor Probleme. „Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass es keine selbstbestimmten Fotos waren“, sagt sie.
Die „Intervention“ ist ein Pilotprojekt, das partizipative Format für die Gedenkstätte erstmalig –und von großer Bedeutung. Denn nicht nur im Umgang mit neuen Generationen braucht es frische Konzepte, sondern auch im Umgang mit den betroffenen Gruppen, ihren bis in die vierte Generation traumatisierten Nachfahren. Margitta Steinbach hat die Gedenkstätte lange gemieden. „Das war ein Spuk für mich“, sagt sie. „Wir haben in unserer Kindheit nicht viel darüber gesprochen. Es war immer ein Schmerz spürbar.“ Auf Klassenfahrt nach Bergen-Belsen ließ ihre Mutter sie nicht mitfahren.
Steinbach ist dankbar, dass die Gedenkstätte diesen Prozess zugelassen hat. „Die Gedenkstätten sind für die Mehrheitsgesellschaft geschaffen worden, nicht für uns Angehörige und Nachfahren. Wir wünschen uns Zugang zu Forschung und Wissenschaft.“ Es gab anfangs unterschiedliche Perspektiven bei der Zusammenarbeit, sagen alle und betonen: „Wir haben uns angenähert.“
Für die Pädagogin Katja Anders bleiben solche Ausstellungen eine schwierige Gratwanderung: „Wie kann man die Objekte als Zeugnisse rassistischer Verfolgung zeigen, ohne den ihnen innewohnenden Rassismus zu reproduzieren“, fragt sie. „Wie vermeide ich, dass die Opfer erneut entwürdigt werden?“
Im Fall der Masken, die man den inhaftierten Sinti und Roma mit Flüssigkunststoff abgenommen hat, entschied sich die Interventionsgruppe nur in den Fällen, wo die Nachfahren ausfindig gemacht und befragt werden konnten, diese zu zeigen. Und zwar hinter einem weißen Vorhang verborgen. Wer will, kann diesen geschützten Raum betreten. Margitta Steinbach will nicht. „Es erschüttert mich jedes Mal bis ins Mark“, sagt sie. „Für mich ist das eine Konfrontation mit dem Trauma, das der Völkermord in unseren Familien hinterlassen hat und das bis heute auch in mir wirkt.“
Guide Daniel Molchanov steuert diesen Teil der Ausstellung mit den Schüler:innen nicht an. Dafür reicht der vorgegebene Zeitrahmen nicht. Es geht um die Basics des Nationalsozialismus. „Was war die SS?“, fragt Molchanov, als die Gruppe auf dem ehemaligen Appellplatz steht. Schweigen, Kopfschütteln. „Das wissen sie nicht“, sagt die Lehrerin. „SS steht für Schutzstaffel“, erklärt der Guide. 1925 von Hitler als Leibgarde gegründet, wurde sie zur mächtigsten Organisation des NS-Regimes ausgebaut.
Das KZ Sachsenhausen war ein Modell- und Schulungslager für die SS, sie unterhielt eigene Wirtschaftsbetriebe, herrschte über Leben und Tod. „Dort“, zeigt Molchanov, „stand der Galgen“, wo demonstrativ Hinrichtungen durchgeführt wurden. Er zeigt auch die „Schuhprüfstrecke“, auf der die Inhaftierten für die Schuh- und Ersatzstoffindustrie rund um den Appellplatz auf unterschiedlichem Grund Materialien probelaufen mussten. Das Schuhläufer-Kommando war ein Todeskommando, viele überlebten die Tortur nicht.

Eine Schülerin sagt hinterher: „Ich finde gut, dass der Besuch der Gedenkstätte für uns eine Pflichtveranstaltung ist.“
„Der Alltag im Lager weckt das Interesse der Jugendlichen am ehesten“, sagt Daniel Molchanov im Nachgespräch. Mit seinen 23 Jahren ist der Student der Politikwissenschaft nicht so viel älter als die Brandenburger Schüler:innen. Molchanov wuchs in Moskau auf, wanderte 2022 nach Israel aus und absolvierte in Sachsenhausen 2023 ein Freiwilliges Soziales Jahr. Seither studiert er in Berlin und ist zertifizierter Guide.
„Ich erlebe viel Unwissen, auch Gleichgültigkeit“, sagt er. Krasse negative Vorfälle habe er bisher „nicht viel“ mitbekommen. „Nur dumme Fragen.“ Manche Jugendliche seien auch interessiert. „Jede Führung ist anders. Es hängt oft von der Vorbereitung und dem Engagement der Lehrkräfte ab.“
Ob diese ihren Schüler:innen den Instagram- oder Tiktok-Kanal (@keine.erinnerungskultur) von Susanne Siegert ans Herz legen würden? „Alles was du in der Schule nicht über Naziverbrechen lernst“ steht provozierend über Siegerts Accounts. Passen Tiktok und Naziverbrechen überhaupt zusammen, lassen sich in kurzen und schnellen Videos Informationen über NS-Gräueltaten aufbereiten?
Es geht erstaunlich gut. Unter den Schlagworten „Opferzahlen“, „Arbeit macht frei“, „Deserteure“, „Mein Uropa“ oder auch „Merz’ Nazigroßvater“ erläutert sie in schneller Bild- und Wortfolge Hintergründe, zeigt historische Fotos, Dokumente, Interviewausschnitte, benennt Quellen und ihre eigenen Zugänge. Sie führt Politiker vor, die schräge historische Vergleiche machen, und bezieht Position gegen die Vereinnahmung der Gedenkkultur durch die Politik bei offiziellen Anlässen. Oder von Margot Friedländer, als sich anlässlich ihres Todes viele Promis mit der Holocaust-Überlebenden und Zeitzeugin zeigten.
Siegert ist keine studierte Historikerin, das betont sie, sie produziert ihre Videos und moderiert ihren Account selbst. Dabei ist sie so erfolgreich, dass sie zum Erscheinen ihres erstes Buchs Anfang November ihren Job aufgegeben hat, um auf Lesetour zu gehen. In „Gedenken neu denken“ stellt sie Überlegungen an, wie man dem offiziellen „Gedächtnistheater“ entgeht, ein Begriff, den sie „dankbar“ von dem Soziologen Y. Michal Bodemann übernommen hat. Gedenkfeiern wie am 8. Mai oder 9. November seien für viele Deutsche zu einem hohl gewordenen Ritual und einer moralischen Entlastung von Schuld geworden. Für Siegert ist dagegen „die Aufarbeitung des Nationalsozialismus kein abgeschlossenes Kapitel“. Es gelte, neue Formate finden, die konkret nach der deutschen Täterschaft fragen.
Was sie damit meint, erklärt die 33-Jährige der taz im Videocall nach Leipzig. So habe sie vor Kurzem ein Video über die Bücherverbrennung gemacht. „Da hatte ich dann diesen Satz im Skript: Die Nazis haben Bücher verbrannt – und das stimmt ja auch“, erzählt sie. „Aber das ist halt super abstrakt und im Grunde eine Leerformel. Was man stattdessen sagen kann, ist, dass die deutsche Studentenschaft die Bücher verbrannt hat. Es waren Studierende, die so begeistert waren vom Nationalsozialismus und die dann auch vom Regime unterstützt wurden. Darum geht es: klare Worte zu finden.“
Siegert sieht ihre Arbeit als Ergänzung zur offiziellen Gedenkarbeit. Junge Menschen nicht erschrecken, nicht überfordern, nicht langweilen – dies könnte man als Siegerts Maxime sehen. Sie Initiative ergreifen lassen, ihr historisches und familienbiografisches Interesse wachkitzeln. Und das ist offenbar hoch. Die Gedenkstätte Neuengamme bietet halbjährlich Workshops zur Familienrecherche in der NS-Zeit an, die sehr gefragt sind.
Siegert wirbt dafür, kleinere, noch unbekannte Tatorte in der eigenen Region zu erforschen. Vor einigen Jahren recherchierte sie die Geschichte des KZ-Außenlagers Mühldorfer Hart in der Nähe ihres bayrischen Heimatortes. Damit begann ihre Laufbahn als Content Creatorin. Außenlager, hat sie dadurch gelernt, entsprächen oft nicht unserer Vorstellung von einem KZ. Das waren oft Firmen, die KZ-Häftlinge beschäftigten, das waren Produktionsstätten der SS, Arbeitskommandos außerhalb der KZ.
Nach dem Krieg waren viele Außenlager zerstört oder verfielen. Was dazu führen kann, dass die bekannten NS-Icons fehlen, sagt Siegert. „Das kann zu Irritationen oder Enttäuschungen führen.“ Darum sei es wichtig, genau hinzugucken, die Bilder, die wir alle im Kopf hätten, zu hinterfragen.
Die Schulgruppe aus Brandenburg, die Daniel Molchanov herumgeführt hat, wirkt erschöpft. „Noch Fragen?“ Keine. Der Bus wartet. Die Jugendlichen haben eine Blatt mit zehn Arbeitsaufträgen bekommen, die von einfachen Wissensfragen bis zu kleineren Recherchen reichen: „Zähle Betriebe aus der Umgebung des KZ auf, die Zwangsarbeiter beschäftigt haben.“ Oder: „Beschreibe das Menschenbild eines Häftlings und das eines Aufsehers, beschreibe deine Vorstellung von beiden …“ Ob sie darüber miteinander auf der Rückfahrt reden werden?
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen








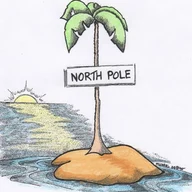

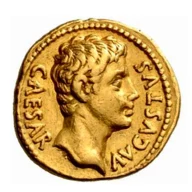
meistkommentiert