Sollte Alkohol höher besteuert werden?: Prost und Contrabier
Alkohol steht zu oft im Mittelpunkt, sagt Drogenbeauftragter Hendrik Streeck. Wären hohe Preise wie in Skandinavien die Lösung? Ein Pro & Contra.
P ro
Deutsche trinken im Durchschnitt pro Jahr etwa 88 Liter Bier, 19 Liter Wein, mehr als drei Liter Sekt und rund 5,1 Liter Spirituosen. Obwohl der Konsum rückläufig ist, wird hier mehr gesoffen als in vielen anderen EU-Ländern.
Klar, für die vielen Unternehmen, die vom Bier und vom Wein leben, wäre es doof, wenn Steuererhöhungen ihre Absätze und Umsätze schmälern würden. Doch reicht das als Grund, es nicht doch zu erwägen? Auch bei all den Gastwirten, die bei der Idee aufschreien, weil sie fürchten, ihren Laden dichtmachen zu müssen, kann man sich fragen: Wieso setzen sie nicht auf alkoholfreie Alternativen oder innovative Barkonzepte?
Denn auf der anderen Seite stehen Verkehrstote, Suchtkranke und diejenigen, die durch die Folgen des Konsums des Nervengifts Alkohol krank werden, das Gesundheitssystem belasten.
Immer wieder kritisieren Experten den Alkoholkonsum in Deutschland, zuletzt Drogenbeauftragter Hendrik Streeck (CDU). Als „stärksten Hebel“ zur Reduzierung des Konsums bezeichnete er den Preis. „Eine Steuererhöhung von 10 Cent pro Bier könnte laut der Deutschen Hauptstelle Sucht jährlich 850 Leben retten und 1,4 Milliarden Euro einbringen“, wurde im April berichtet. Wie viel wohl in Bildung und Infrastruktur modernisiert werden könnte, mit diesen 1,4 Milliarden Euro?
Oder man schlägt gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche und steckt das Geld, das durch eine Steuererhöhung eingenommen würde, in die Förderung von Freizeitangeboten, welche die Gesundheit fördern, statt sie zu korrumpieren. Immerhin will die Lücke, die eine Verteuerung des Saufens in die Wochenendplanung vieler Menschen reißen würde, gefüllt werden.
Immer wieder schlagen Kritiker der Steuererhöhung „mehr Aufklärung“ als Alternative vor. Doch im Land der Dichten und Denker, in dem das Anstoßen bei allem, was es irgendwie zu feiern gibt, so tief verwurzelt ist, kommt Aufklärung allein nicht an diese Wurzeln heran.
Laut der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen kostet Alkohol das Gesundheitssystem 57 Milliarden Euro, für Arztrechnungen, Krankenhausaufenthalte und Medikamente. Wäre es nicht besser für alle, wenn durch weniger Saufen mehr Geld – und Zeit – für nicht eigenverschuldete Gesundheitsprobleme übrig wäre?
Die Deutschen müssten sich das Leben weniger schön trinken, wenn es schöner wäre. Wenn Gesundheit weniger kosten würde. Wenn der Vater nach dem Dorffest nicht besoffen gegen den Baum gefahren oder auf dem Fahrrad von einem betrunkenen Fahrer erfasst worden wäre. Eine Steuererhöhung allein löst die Probleme natürlich nicht. Und doch wäre sie ein Schritt in Richtung bessere Gesellschaft.
Während es hier eine Branntweinsteuer von knapp über 13 Euro pro Liter Reinalkohol gibt, besteuert Schweden Spirituosen mit 60 Euro pro Liter Reinalkohol. In Großbritannien fallen dafür umgerechnet 33 Euro Steuer an. Es ist also möglich, mehr für Alkohol zu berechnen.
Und wer in einer Erhöhung der Alkoholsteuer eine Einschränkung der Freiheit sieht, übersieht, wie tief verwurzelt die Saufkultur in Deutschland ist, wo das Trinken so selbstverständlich ist, dass man immer noch oft komisch beäugt wird, wenn man auf dem Geburtstag, Betriebsfest oder Weihnachtsmarkt nicht trinkt; dass das vorherrschende „Normal“ Druck macht und die Freiheit beschränkt. Klaudia Lagozinski

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.
Contra
Es gibt ein massives Alkoholproblem in Deutschland, darüber müssen wir nicht streiten. Viel zu viele Menschen trinken viel zu viel. Viel zu viele werden davon krank oder saufen sich zu Tode. Da liegt es nahe, den gefährlichen Stoff einfach teurer zu machen, wie es der Drogenbeauftragte Hendrik Streeck (CDU) jetzt angeregt hat, der den Preis als „stärksten Hebel“ empfiehlt, „um den Konsum zu reduzieren“. Klingt schlüssig. Aber wie so viele scheinbar einfache Lösungen hat auch diese einen Haken: Es wäre hochgradig unsozial.
Aus einer Verteuerung von Bier, Wein und Schnaps könnten sich neue Gefahren ergeben – für die Gesellschaft und für die Gesundheit. Ein paar Cent mehr Steuern auf Alkohol, die jeder zahlen könnte, würden ja nicht reichen. Um das Konsumverhalten wirklich deutlich zu verändern, müsste der Preis deutlich angehoben werden. Das würde die Reichen kaum stören, aber die Mittelschicht durchaus und die Armen umso mehr. Nun könnte man sagen: Ist doch gut, dann saufen die eben weniger, umso besser! Das wäre jedoch extrem hochnäsig und paternalistisch.
Außerdem würde es den Umstand unterschlagen, dass längst nicht alle AlkoholkonsumentInnen sofort krank und süchtig werden, also am besten jeder Schluck verhindert werden muss und dafür jedes Mittel recht ist. Alkohol ist sicher nicht gesund, aber kein Heroin oder Crack. Selbst der frühere, eindeutig gesundheitsbewusste und salzfrei lebende Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hielt ein Glas Wein am Tag für unbedenklich. Darüber konnte dann gestritten werden.
Auf jeden Fall schaffen es viele Millionen Menschen in Deutschland, gemäßigt Alkohol zu trinken, ohne davon krank zu werden. Und das kann, ja das muss man auch armen Menschen zutrauen. Eine Preisverteuerung würde sie krass benachteiligen und im wahrsten Sinn des Wortes bevormunden, während der Schampus im Golfklub weiter fließt.
Wer genug Geld hat, könnte sein Feierabendbier auch dann genießen, wenn es 10 Euro kostet. Wer von der Grundsicherung oder kargen Löhnen leben muss, aber nicht. Wollen wir wirklich, dass Arbeitslose nie mehr in eine Kneipe nebenan gehen können? Diese Ungerechtigkeit mag CDU-Politiker nicht stören, würde aber zu berechtigtem Unmut führen und wäre der sicherste Hebel, um neue gesellschaftliche Spannungen zu erzeugen. Wie bei einer rigorosen Verteuerung von Fleisch und Fliegen und Heizen ohne sozialen Ausgleich für die Ärmeren. Welche Partei am meisten von drastisch erhöhten Bierpreisen profitieren könnte, kann man sich denken.
Wer selbst das in Kauf zu nehmen bereit ist, sollte bedenken: Auch noch so hohe Alkoholpreise würden das seit Menschengedenken vorhandene Rauschbedürfnis nicht ausrotten. Zu befürchten wäre, dass viele suchtgefährdete Menschen auf irgendeinen heimlich importierten Billigfusel oder illegal gebrannten Schnaps ausweichen würden, die noch gefährlicher wären.
Sinnvoller als eine höhere Alkoholsteuer wären deshalb Maßnahmen, die niemanden finanziell benachteiligen: Vielleicht ein höheres Einstiegsalter und ein Verbot des „begleiteten Trinkens“ in Gaststätten, wie es Streeck vorschlägt: dass Jugendliche dort also auch in Begleitung ihrer Eltern keinen Alkohol trinken dürfen. Oder ein Verbot von Alkoholwerbung. Auf jeden Fall mehr Zuwendung, medizinische und psychologische Hilfe für Alkoholkranke. Aber bitte keine unsoziale Preissteigerung. Lukas Wallraff
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen









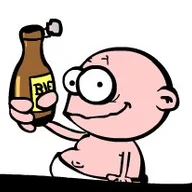



meistkommentiert