
Antifa-Prozess beginnt: Die Abrechnung
Eine Gruppe um Johann G. soll jahrelang Rechtsextreme attackiert haben. Nach vier Jahren im Untergrund steht er nun in Dresden vor Gericht.
E s war am Vormittag des 9. Februar 2023, ein Donnerstag, als Johann G. mit mehreren anderen Linken aus Sachsen und Thüringen in Budapest losgezogen sein soll. Rechtsextreme aus ganz Europa hatten sich in diesen Tagen in der ungarischen Hauptstadt versammelt, zu ihrem alljährlichen Tag der Ehre. Bei dem Aufmarsch verherrlichen sie die SS und Wehrmacht, die hier 1945 eingekesselt gegen die Rote Armee kämpfte. Einige Neonazis tragen dafür Uniformen und Stahlhelme, zeigen Hakenkreuze. Und wie in den Vorjahren gab es linken Gegenprotest. Johann G. und die anderen aber sollen diesmal mehr gewollt haben.
Schon am Morgen sollen zwei Mitstreiter aus der Gruppe am Budapester Westbahnhof einen bekannten ungarischen Neonazi, der in Szenekleidung zwischen den Zugtüren stand, entdeckt und ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Eine Stunde später soll dann auch Johann G. mit anderen losgezogen sein. Sie wiederum erspähten drei polnische Rechtsextreme, die sie verfolgten und schließlich vor einem Café in der Innenstadt angriffen, Johann G. soll dabei mit einem Schlagstock zugeschlagen haben, ein anderer Vermummter einen Hammer dabei gehabt haben. Auch als ein Angegriffener schon am Boden lag, soll weiter geprügelt worden sein. Erst als sein Begleiter ein Pfefferspray zückte, hätten die Vermummten die Flucht ergriffen.
In den beiden Tagen darauf folgten drei weitere Angriffe. Insgesamt neun Rechtsextreme werden in Budapest verletzt. Sie erleiden Kopfplatzwunden, Knochenbrüche, Prellungen. Ein Opfer soll mehr als 15 Schläge auf den Kopf bekommen haben – auch hier soll Johann G. mit zugeschlagen haben. Ein weiterer Angegriffener sei, als er schon bewusstlos auf dem Gehsteig lag, noch mit Schlägen traktiert worden.
All dies geht aus Ermittlungsergebnissen der Bundesanwaltschaft hervor. Und wenn Johann G. tatsächlich bei diesen Taten in Budapest dabei war, würde es eine gewisse Chuzpe bedeuten: Denn der 32-Jährige wurde damals schon seit knapp drei Jahren vom BKA und Zielfahndern der sächsischen „Soko Linx“ gesucht, mit internationalem Haftbefehl, als Topziel. Wegen mehrerer Angriffe auf Rechtsextreme in Ostdeutschland mit demselben Tatmuster.
Aber auch in Budapest entkam Johann G. offenbar wieder. Anderthalb Jahre blieb er danach noch verschwunden. Trotz veröffentlichter Fahndungsfotos, trotz ausgelobter Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise, trotz Ausstrahlung seines Falls in der TV-Sendung „XY ungelöst“. Dann, am 8. November 2024, ein Freitagvormittag, fasste ihn die Polizei doch noch: in einer Regionalbahn bei Weimar. Fahnder hatten zuvor eine Thüringer Bekannte von ihm observiert, die in der Bahn saß. Dann soll Johann G. dazugestiegen sein – und wurde festgenommen.
Der Prozess um Johann G. fängt am Dienstag an
Zur Festnahme äußerte sich damals selbst die amtierende Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die von einem „sehr wichtigen Fahndungserfolg“ sprach. Denn es seien bei linksextremen Gruppen „Hemmschwellen gesunken, politische Gegner mit äußerster Brutalität anzugreifen“, so die Sozialdemokratin. Sachsens Innenminister Armin Schuster, CDU, frohlockte, dass einer „der meistgesuchten Linksextremisten“ festgenommen wurde: der „Drahtzieher vielfältiger schwerer Straftaten“ und „das zentrale Puzzleteil im gesamten Ermittlungskomplex“.
Ab Dienstag nun wird Johann G. mit sechs anderen Linken in Dresden vor dem Oberlandesgericht stehen, in einem Hochsicherheitssaal am Stadtrand, angeklagt von der Bundesanwaltschaft. Die Vorwürfe gegen die Gruppe, die Medien mal als „Antifa Ost“, mal als „Hammerbande“ titulieren: neun schwere Angriffe auf Neonazis, begangen von Oktober 2018 bis Februar 2023 in Wurzen, Leipzig, Dessau-Roßlau, Eisenach, Erfurt, die letzten in Budapest. Dazu ein Angriff auf ein Geschäft der bei Rechtsextremen beliebten Modemarke Thor Steinar in Dortmund.
Einige der Neonazis wurden vorher ausgespäht und in ihrem Wohnumfeld attackiert. Andere, als sie von Aufmärschen zurückkehrten. In Eisenach war es der Anführer der rechtsextremen Kampfsporttruppe Knockout51, Leon Ringl, der gleich zwei Mal angegriffen wurde. In Leipzig-Connewitz traf es spontan einen Kanalarbeiter, der eine Mütze einer bei Rechtsextremen beliebten Marke trug. Johann G. soll an acht der neun Taten beteiligt gewesen sein – die anderen Beschuldigten bei einzelnen Angriffen.
Und die Bundesanwaltschaft hängt die Vorwürfe hoch: Sie wirft allen Angeklagten die Bildung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung vor sowie gefährliche Körperverletzungen. Und in zwei Fällen, bei den Angriffen in Erfurt und Dessau-Roßlau, auch versuchten Mord, weil die Attackierten dort auch mit Schlagstöcken und Hämmern gezielt auf die Köpfe geschlagen wurden, was zu lebensgefährlichen Verletzungen geführt habe. Zwei der Opfer mussten auf einer Intensivstation behandelt werden, einer mit Einblutungen in den Schädelinnenraum. Neben Johann G. sitzen drei weitere Beschuldigte seit Monaten in Untersuchungshaft. Zwei von ihnen hatte die taz zuletzt im Gefängnis besucht: die Berliner Thomas J. und Tobias E.
Ihnen steht nun der größte Antifa-Prozess seit Jahren bevor, Verhandlungstermine sind bis ins Jahr 2027 vorgesehen. Und das Verfahren setzt im Grunde einen anderen Prozess fort, in dem im Mai 2023 an selber Stelle vier Antifaschist*innen wegen der selben Angriffsserie zu Haftstrafen verurteilt wurden. Hauptbeschuldigte war damals: die Leipzigerin Lina E., verurteilt zu gut fünf Jahren Haft, die sie momentan absitzt – die frühere Verlobte von Johann G. Schon damals galt ihr Lebensgefährte als mutmaßlicher Gruppenanführer. Da aber war er noch auf der Flucht – und soll weiter Straftaten begangen haben.
Und Druck kommt inzwischen auch aus dem Ausland. Denn schon im September stufte die ungarische Rechtsaußen-Regierung von Viktor Orbán die „Antifa Ost / Hammerbande“ als terroristische Vereinigung ein. Nun tat es vor einer guten Woche die US-Administration von Donald Trump gleich und erklärte, man werde Antifagruppen „auf der ganzen Welt bekämpfen“.
Johann G. und die Mitbeschuldigten schweigen bisher
Den Verteidiger*innen der in Dresden Angeklagten schwant deshalb nichts Gutes. Bereits zur Anklageerhebung beklagten sie in einer Erklärung, es sei „höchst zweifelhaft, ob diese Anklage in einem fairen und rechtsstaatlichen Verfahren verhandelt werden kann“. Das LKA Sachsen habe „nicht neutral“ ermittelt. Dem LKA warfen sie vor, Verfahrensinhalte rechtswidrig weitergegeben zu haben, stellten deshalb Anzeige wegen Geheimnisverrats. „Das Vorgehen des LKA Sachsen verstößt fundamental gegen die Unschuldsvermutung.“
Am Montag nun kritisierten die Anwält*innen, dass die Anklage das „Konstrukt einer Vereinigung“ schaffe und den Vorwurf einer kriminellen Vereinigung „erheblich“ ausweite. Benannt werde gar keine feste Organisationsstruktur mit Mitgliedern und Hierarchien. Mehrere Angeklagte seien „lediglich Randpersonen“, die nur an einer der vorgeworfenen Taten beteiligt gewesen sein sollen.
Zudem gaben die Verteidiger*innen bekannt, dass sie einen Befangenheitsantrag gegen den Strafsenat eingereicht haben. Denn drei der fünf Richter*innen hätten schon beim Prozess gegen Lina E. und die anderen mitgewirkt – und dort bereits Schuldfeststellungen zu einigen Beschuldigten getroffen, etwa dass diese Teil einer kriminellen Vereinigung gewesen seien oder ein Kronzeuge glaubhaft war. Deshalb sei nicht davon auszugehen, dass diese Richter*innen im jetzigen Prozess unvoreingenommen seien. Laut der Verteidigung wurde der Befangenheitsantrag aber bereits am Sonntag abgelehnt, „weshalb diese Frage später von höheren Gerichten geprüft werden muss“.
Johann G. und die Mitbeschuldigten schweigen bisher, ob sie etwas mit den angeklagten Taten zu tun haben. Auch Thomas J. und Tobias E., durften bei den Haftbesuchen der taz, nichts zu Verfahrensinhalten sagen – LKA-Beamte wachten darüber. Thomas J., mit 48 Jahren der älteste Beschuldigte, erinnerte aber im Gespräch daran, dass der Eisenacher Neonazi Leon Ringl mit seiner Kampfsportgruppe jahrelang Menschen verprügelte und in seiner Stadt einen „Nazi-Kiez“ errichten wollte. Antifa-Gruppen hätten früh darauf aufmerksam gemacht, lange ohne dass die Polizei eingeschritten sei. „Das war nicht irgendwer“, sagte Thomas J. im Besucherraum der Berliner JVA Moabit. „Wie weit sollte das noch gehen?“
Auch im ersten Dresdner Prozess, 2021, schwiegen Lina E. und die anderen Beschuldigten. In einer Erklärung aber betonten auch sie damals: Man müsse „über die gesellschaftliche Realität rechter Gewalt sprechen, die antifaschistisches Engagement notwendig macht“. Rechter Terror, AfD-Wahlerfolge, rechtsoffene Coronaproteste, Neonazi-Übergriffe – dagegen hätten „alle Formen antifaschistischer Arbeit ihre Berechtigung“. Es sei „nicht hinnehmbar, aus Mangel an eigener Betroffenheit wegzuschauen“.
Für die Sicherheitsbehörden aber ist gerade Johann G. ein linker Gewalttäter, den sie lange hinter Gittern sehen wollen. Schon vor Jahren stuften sie ihn als Gefährder ein, dem schwerste Straftaten zugetraut werden. In der Anklage der Bundesanwaltschaft heißt es, seiner Gruppe sei es mit den Angriffen darum gegangen, Rechtsextreme „nachhaltig“ in ihren Aktivitäten zu stoppen und andere Szeneangehörige durch die Signalwirkung abzuschrecken.
Der Weg von Johann G. in die Antifa begann früh. Aufgewachsen in Leipzig trennten sich die Eltern in seiner Kindheit. Als 11-Jähriger zog er mit seiner Mutter nach Bayern, machte dort sein Abitur mit einem 3,5-Notenschnitt. Und fiel schon zu Schulzeiten als Sprayer und bei der Antifa auf – und mit Straftaten. Bereits 2009, als 15-Jähriger, erhält er wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch zwei richterliche Weisungen. Es folgen weitere Prozesse und eine erste Woche Jugendarrest, dann eine dreijährige Bewährungsstrafe. 2012 attestiert ihm ein Gericht eine „verantwortungslos dahintreibende Lebensweise“ und einen „eventorientierten Krawalltourismus“.
Als Johann G. nach dem Abitur zurück nach Leipzig geht, für ein Jahr Bundesfreiwilligendienst und ein Geschichtsstudium, geht es so weiter. 2015 wird er wieder verurteilt, erst zu einer Geldstrafe für eine Sachbeschädigung, dann weil er mit anderen drei Teilnehmende eines Legida-Aufmarschs angriff, eine Frau beschimpfte er dabei als „Nazischlampe“. Auch weil er da noch unter Bewährung stand, muss er nun für gut ein Jahr in Haft. Die frühere Prognose, dass sich Johann G. zu „ernsthafter, gewaltfreier politischer Betätigung gewendet“ habe, habe sich nicht bestätigt, halten die Richter fest. G. sitzt die Haftstrafe komplett ab.
Johann G. taucht ab
Noch zuvor aber lernt Johann G. in Leipzig Lina E. kennen, Anfang 2016 verloben sie sich. Und seine politische Haltung tätowiert sich Johann G. auf die Haut. „Hate cops“ steht nun auf seinen Fingern. Im April 2018 folgt dann die nächste Verurteilung zu einer Haftstrafe – wegen Steinwürfen auf einer Autonomen-Demonstration in Leipzig.
Vor Gericht bestreitet Johann G. die Vorwürfe und beteuert, die gefundene DNA an den Steinen komme daher, dass er erkältet darauf genießt habe. Das Gericht glaubt ihm nicht und schickt ihn diesmal für ein Jahr und drei Monate in Haft. In seinem Leben habe sich „offenbar nicht wirklich Grundlegendes geändert“, monieren die Richter erneut. Sein Studium verfolge er „allenfalls halbherzig“, sein Weg bleibe „recht ziellos und unbestimmt“.
Es ist ein halbes Jahr nach dieser Verurteilung, als im Oktober 2018 die erste Tat verübt wird, die nun vor dem Oberlandesgericht Dresden angeklagt ist. Ein Angriff auf einen früheren NPD-Politiker in Wurzen. der vor seinem Wohnhaus niedergeschlagen wird. Johann G. wird eine Mitwirkung daran nicht vorgeworfen, aber einer Mitangeklagten, die den Rechtsextremen ausgespäht haben soll. An allen acht folgenden Taten aber soll Johann G. dann laut Anklage beteiligt gewesen sein – entweder indem er selbst zuschlug, Rechtsextreme ausspähte oder, im Fall des Dortmunder Thor Steinar-Geschäfts, ein Video der Tat ins Internet gestellt habe.
In dem Video ist zu sehen, wie ein Vermummter eine Glasflasche mit einer Flüssigkeit, offenbar Buttersäure, in den Laden wirft, ein zweiter mit einem Feuerlöscher Bitumen auf die Verkaufsflächen versprüht. Eine Verkäuferin kreischt vor Schreck. „Scheiß Nazischweine“, ruft einer der Vermummten, bevor er nach wenigen Sekunden aus dem Geschäft rennt. Das Video wurde später auf der linken Onlineplattform Indymedia veröffentlicht, verbunden mit dem Aufruf zu Spenden via Bitcoins – für weitere „offensive Projekte“.
Im Dezember 2019, nach dem sechsten Angriff, einer Attacke auf den Eisenacher Leon Ringl, wird schließlich Lina E. mit einem weiteren Leipziger Linken in einem Fluchtauto gefasst, dem VW Golf ihrer Mutter. Auch ein zweites Auto mit mehreren Antifas stoppt die Polizei. Es ist dieser Moment, ab dem die Polizei nun konkrete Verdächtige hat – und ab dem die „Soko Linx“ die linke Szene Leipzigs mit Razzien durchzieht. Und der Moment, nach dem sich Johann G. kurz darauf absetzt.
Über die Schweiz soll er zunächst nach Thailand gereist sein. Einige Monate später soll Johann G. wieder nach Deutschland zurückgekehrt sein, sich auch in Leipzig und am Ende in Berlin aufgehalten haben, zwischenzeitlich in Griechenland. Trotz der Fahndung soll Johann G. im Frühjahr 2023 noch an Angriffen auf zwei Rechtsextreme in Erfurt und bei denen in Budapest dabei gewesen sein. Auch danach taucht noch in Leipzig ein Graffiti auf, „Catch me if you can“ oder „Most wanted“, dazu der Name „Spyle“. Es ist der Sprayername von Johann G.
Noch zu Anfang seines Abtauchens soll Johann G. auch Kontakt zu Lina E. gehalten, ihr Briefe ins Gefängnis geschickt haben, mit verfälschtem Absender. Dann aber trennte er sich – und kam offenbar mit einer anderen Szenebekannten zusammen, der ebenfalls vorgeworfen wird, in Budapest dabei gewesen zu sein. Und dann, im November 2024, wird G. tatsächlich gefasst.
Die Frage vor dem Oberlandesgericht Dresden lautet nun: Waren Johann G. und die Mitbeschuldigten tatsächlich an all den angeklagten Taten beteiligt? Gab es dafür wirklich eine feste Gruppe? Oder noch ganz andere Verantwortliche? Und waren zwei der Angriffe wirklich versuchte Morde?
Die Anklage stützt sich im Fall von Johann G. bei ihrer Anklage auf Aufnahmen von Überwachungskameras in Budapest, auf Bilder aus einer Regionalbahn bei Wurzen oder auf Handyvideos von Passanten in Erfurt. Am Tatort in Eisenach fand sich auch Blut von ihm, er wurde in der Nähe auf einem Blitzerfoto abgelichtet. Auch an einem anderen Tatort, am Bahnhof Dessau-Roßlau, sollen DNA-Spuren von G. gefunden worden sein. Bei den anderen Taten sind es Indizien, welche die Bundesanwaltschaft zusammenführt: mehrdeutige Sätze aus abgehörten Gesprächen, verdächtige Messengernachrichten, oder eine gefundene Dachbox auf dem Dachboden eines Leipziger Mietshauses, in dem Schlagstöcke, Sturmhauben, Polizei-Patches oder Hämmer verstaut waren, samt DNA-Spuren von einigen Beschuldigten – laut Ermittlern das „Tatmitteldepot“ der Gruppe.
Vor allem aber sind es die Aussagen eines Kronzeugen, auf denen die Bundesanwaltschaft ihre Anklage stützt: die von Johannes D. Der 33-jährige Szenefreund kannte Johann G. schon aus Bayern, hielt zu ihm anfangs auch noch Kontakt, als er in Thailand war. Im Herbst 2021dann aber wurde Johannes D. als „Vergewaltiger“ in der linken Szene geoutet und verstoßen. Darauf packte er bei Ermittlern über die Leipziger Gruppe aus, nannte Namen, wer angeblich dazu gehörte und wer bei Aktionen dabei war. Ziel der Gruppe, so der Berliner, sei es gewesen, die Neonazis„psychisch zu brechen“.
Und er beschuldigte Lina E. und Johann G. schwer: Sie hätten die Gruppe zusammengehalten, Trainings und Leute für Angriffe organisiert.Aus einem „flexiblen Geflecht“ von Autonomen aus mehreren Städten hätten sich dabei bedient. Das Paar sei „ebenbürtig“ gewesen: Lina E. „ruhig, fokussiert, überlegter“.Johann G. impulsiv, aber mit „Führungsgeschick“, und einer, der auch Equipment oder Bahntickets Erster Klasse besorgen konnte – „gecarded“, bezahlt mit geklauten oder gefälschten Kreditkartendaten.
Es sind die Aussagen von Johannes D., derentwegen nun einige Angeklagte überhaupt vor Gericht stehen. Thomas J. aus Berlin etwa, von dem D. den Ermittlern erzählte, dieser sei bei einem der zwei Angriffe in Eisenach dabei gewesen und habe zwei Kampftrainings für die Gruppe angeleitet. Zu Tobias E. erzählte D., dass auch dieser in Eisenach und in Dessau-Roßlau dabei war. Genau das wirft nun die Anklage den beiden Linken vor. Im Fall von Tobias E. beruft sich die Bundesanwaltschaft dabei aber auch auf DNA-Spuren von ihm in Dessau-Roßlau, an einer Plastiktüte, in die ein Schlagwerkzeug gewickelt war. Zudem wurde Tobias E. in Budapest noch vor Ort festgenommen und saß dafür fast zwei Jahre in Ungarn in Haft.
Schon im ersten Prozess gegen Lina E. sagte Johannes D. ganze zwölf Prozesstage lang aus. Verteidiger*innen warfen ihm damals reine Spekulationen vor: Er reime sich vieles zusammen, denn schließlich sei er – außer einmal fernab als Späher – auch nach eigener Auskunft bei keiner der vorgeworfenen Taten selbst dabei gewesen. Zudem habe er den Ermittlern Informationen liefern müssen, um selbst einen Strafrabatt zu erhalten – den er am Ende mit einer Bewährungsstrafe auch bekam. Die Richter im Lina E.-Prozess aber glaubten Johannes D.: Dieser habe sachlich, detailliert und im Einklang mit den Ermittlungsergebnissen berichtet.D. lebt nun in einem Zeugenschutzprogramm. Nun im zweiten Dresden-Prozess wird er erneut als Kronzeuge aussagen.
Und die Anklage stützt sich auch auf ein umstrittenes 3D-Modell des sächsischen Forensikers Dirk Labudde. Dieser ließ Johann G. mit Lasern vermessen, erstellte ein 3D-Modell von ihm. Dann glich er dieses mit Überwachungsvideos aus Budapest ab. Das Ergebnis: Ein Vermummter passe zur Statur von Johann G. Auch bei den Videos des Angriffs in Erfurt errechnete Labudde die Körpergrößen und fand, dass eine Person mit weißer Sturmhaube zu Johann G. passe. Zu sehen sind auf dem Video drei Vermummte, die vor einem Wohnhausblock auf einen am Boden Liegenden einprügeln. Auf einem zweiten Video rennen dann sechs Vermummte davon. „Scheiß Nazis sind das“, ruft einer.
Das 3D-Verfahren wurde zuletzt bereits in einem Prozess gegen eine weitere Linke verwendet: die Kunststudentin Hanna S. in München. Auch ihr wurde vorgeworfen, bei zwei der Angriffe in Budapest dabei gewesen zu sein. Ihre Verteidiger kritisierten die 3D-Methode als unbrauchbar, weil zu ungenau. Eine Identifizierung einer Person sei damit nicht möglich. Auch das Gericht stützte sein Urteil letztlich nicht auf das Modell, sondern berief sich auf andere Indizien – erklärte aber, das Modellergebnis widerspreche jedenfalls auch nicht dem Tatvorwurf. Hanna S. wurde letztlich zu fünf Jahren Haft verurteilt. Es gebe keine gute politische Gewalt, erklärte das Gericht – so wie es auch die Richter beim Urteil gegen Lina E. taten.
Der Mord-Vorwurf wird zurückgewiesen
Zumindest einen Vorwurf aber wies das Münchner Gericht zurück: Dass die Angriffe in Budapest versuchte Morde waren. Zwar seien die Opfer schwer verletzt worden, aber ihren Tod hätten die Angreifer zu keiner Zeit in Kauf genommen. Und auch im Prozess gegen Lina E. und die anderen erfolgten die Verurteilungen wegen gefährlicher Körperverletzungen. Die Bundesanwaltschaft erhebt nun den Vorwurf des versuchten Mordes aber nicht nur in Dresden, sondern auch in einem weiteren Großprozess gegen sechs Antifaschistinnen, der im Januar in Düsseldorf beginnt, auch wegen der Angriffe in Budapest. Eine weitere Person steht dafür derzeit in Ungarn vor Gericht: die nonbinäre Thüringer*in Maja T., der 24 Jahre Haft drohen.
In der linken Szene läuft deshalb bereits seit Monaten Solidaritätsarbeit für die Beschuldigten. Auch am Dienstag soll es vor dem Dresdner Gericht eine Kundgebung geben. Die „Rote Hilfe“ sieht die „nächste Runde der Rachejustiz“. Eher intern läuft aber auch eine kontroverse Debatte über die militanten Angriffe, gibt es Vorwürfe, die Gruppe um Johann G. seien „Antifa-Macker“. Schon im Frühjahr 2023 erklärte die Leipziger Gruppe kappa, man müsse über die „Sinnhaftigkeit mancher militanten Praxis“ reden. „Militante Aktionsformen sollten nicht vorschnell verworfen werden, jedoch auch nicht zum Selbstzweck verkommen.“ Es brauche eine gesellschaftliche Einbettung, sonst drohe ein „Gewaltfetisch“. Und erst kürzlich schrieben Soli-Gruppen für die Dresdner Angeklagten über „Herausforderungen und Widersprüche“ ihrer Arbeit. Die Verhältnisse forderten „antifaschistische Selbstverteidigung“, zugleich aber müsse man „patriarchales und misogynes Verhalten“ einiger Beschuldigter ansprechen – Namen wurden nicht genannt. Auch finde in Teilen der Szene „eine Glorifizierung bestimmter Aktionsformen statt“ – mit der Gefahr, „Kritik zu immunisieren und patriarchale Strukturen zu reproduzieren“. Trotz der Widersprüche bleibe man aber „vereint gegen Repression“.
Die Beschuldigten oder ihre Verteidiger*innen äußerten sich zu der Kritik bisher nicht. Sie kritisierten dafür am Montag, dass das Dresdner Verfahren das rechte Narrativ bediene, Antifaschismus zum Feindbild zu erklären und mit Terrorismus gleichzusetzen. Ein Auswuchs davon sei auch die Einstufung der Gruppe als terroristische Vereinigung durch die USA und Ungarn. „Antifaschismus ist kein Feindbild“, so die Anwält*innen. „Er sollte in einer demokratischen, den Menschenrechten verpflichtenden Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit sein.“
Auf die Terroreinstufung hatten deutsche Behörden überrascht reagiert. Die USA hätten dies „eigenständig entschieden“, erklärte das Auswärtige Amt. Die Trump-Regierung ließ auf Nachfrage offen, welche konkreten Personen dies betrifft und erklärte nur, dass Mitgliedern nun der Zugang zum US-Finanzsystem versagt sei. US-Bezüge der „Antifa Ost“ gibt es aber gar nicht. Der Schritt bleibt damit vorerst Symbolpolitik. Schon jetzt aber sind US-Einreisen schwierig bis unmöglich bei extremistischen Vorstrafen.
Für Johann G. und die anderen Angeklagten in Dresden geht es vorerst aber darum, ob und wie lange sie jetzt in Haft wandern – oder bleiben. Vor allem für Johann G. stehen dabei sehr viele Jahre im Raum. Die Sicherheitsbehörden feiern schon jetzt einen Erfolg: Denn seit den Festnahmen hat die Angriffsserie auf Rechtsextreme in Ostdeutschland vorerst geendet. Das Bundesinnenministerium betont, dass sich das Gefährdungspotential der „Antifa Ost“ damit „zuletzt erheblich verringert habe“. Was sich nicht verringert hat, ist die rechtsextreme Bedrohungslage: Die Gewalttaten der rechten Szene lagen im vergangenen Jahr auf einem Rekordhoch.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen


















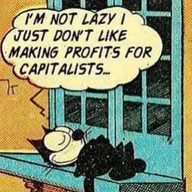

meistkommentiert