Entscheidung über die Schulform: Kreuzchen-Empfehlung soll weg
Gymnasialempfehlungen kränken die Kinder, diskriminieren Stadtteilschulen und seien nicht sinnvoll, sagt die parteilose Abgeordnete Dora Heyenn
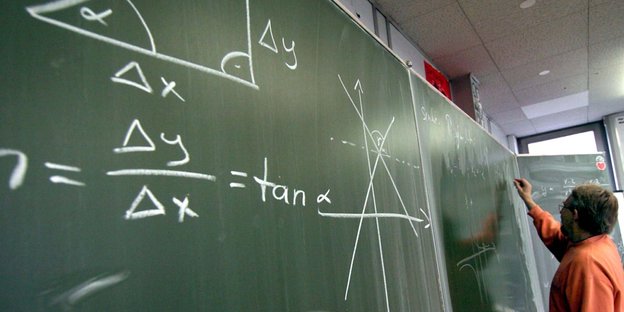
Zu kompliziert oder nicht? Die Empfehlung, wer auf welche Schule soll, kann verhängnisvoll sein Foto: dpa
HAMBURG taz | Mit den Zeugnissen brachten alle Viertklässler gerade wieder noch ein besonders toxisches Papier mit nach Hause: einen Zettel mit einem Kreuzchen. Bei etwa vier von zehn Kindern ist angekreuzt, dass sie ihre Schulzeit auch am Gymnasium fortsetzen könnten. Bei den übrigen ist nur „in der Stadtteilschule“ angekreuzt. Die parteilose Abgeordnete Dora Heyenn will diese Kreuzchen-Praxis beenden. Mit der Lehrer-Initiative Bildungsclub hat sie jetzt eine Unterschriftensammlung gestartet. Überschrift: „Grundschulempfehlung – Nein danke!“
Denn seit 2010 ist die Kreuzchen-Empfehlung „nicht mehr vom Schulgesetz gedeckt“, sagt Ulrich Vieluf, ehemaliger Staatsrat der Schulbehörde und Schulforscher, der am Mittwochabend auf einer Tagung im Rathaus zu Gast war, zu der Heyenn und Bildungsclub eingeladen hatten. Heyenn war 2010 Chefin der Linksfraktion und ebenso wie Vieluf dabei, als nach dem Stopp der sechsjährigen Primarschule alle Parteien über ein neues Gesetz verhandelten.
Die Schulformempfehlung wird wegfallen, berichtete damals die taz und zitierte den Grünen Michael Gwodsz mit den Worten: „Den Zettel mit Ja oder Nein wird es nicht mehr geben.“ Stattdessen sollten die Eltern zur schulischen Zukunft ihrer Kinder nach der Grundschule beraten werden und dann entscheiden. Die Zeugniskonferenz sollte nur eine Einschätzung zur Laufbahn und Lernentwicklung des Kindes geben.
Doch die Kreuze blieben. Bekanntlich platzte die schwarz-grüne Regierung und der Interims-Schulsenator Dietrich Wersich (CDU) packte den Kindern im Januar 2011 einfach wieder einen Zettel mit der Kreuzchen-Empfehlung mit in den Ranzen. Sein Nachfolger Ties Rabe (SPD) blieb dabei.
Wie sehr Herkunft die Gymnasial-Empfehlung bestimmt, machte 1997 die LAU-Schulstudie klar. Ein Kind brauchte dafür im Schnitt 77,6 Lernstandpunkte. Hatte der Vater Abi, gab es die Empfehlung ab 65 Punkten. Hatte der Vater keinen Abschluss, brauchte ein Kind 97,5 Punkte.
Eine Erhebung an 35 Stadtteilschulen zu Beginn der 11. Klasse ergab 2015 beim Deutsch-Leseverständnis 80 Prozent Leistungsüberschneidung mit den Elftklässlern der Gymnasien, die 2009 in der Kess-Studie getestet wurden. Die Stadtteilschüler hatten da noch ein Jahr mehr Lernzeit vor sich. Für die Schulforscher ist das ein gutes Ergebnis.
Das ist schon deshalb fragwürdig, weil das Abitur sowohl am Gymnasium als auch an der Stadtteilschule erreicht werden kann. Anders als öffentlich wahrgenommen gebe es an der Stadtteilschule auch kein „Abitur light“, sagt Vieluf. Die Zahlen beeindrucken: Nicht mal fünf von 100 Kindern an der Stadtteilschule haben ein Gymnasiums-Kreuz. Misst man ihren Lernstand am Anfang der Oberstufe, gibt es beim Lesen 80 Prozent Überschneidung mit den Elftklässlern der Gymnasien. Doch weil alle das Stadtteilschul-Kreuz erhalten und nur wenige dazu das Gymnasium als Option, entstehe eine „Hierarchisierung, die der Gleichwertigkeit widerspricht“, sagt Vieluf. Für das Selbstwertgefühl der Kinder sei das katastrophal.
Dass Lehrer bei Zehnjährigen nicht vorhersagen können, ob sie in der Schule Erfolg haben werden, schreibt selbst der Senat. Es existiere auch kein „prognostisches Verfahren, dass darüber Auskunft geben könnte“, heißt es in der Antwort auf eine Parlamentsanfrage.
Lehrer sind oft unsicher und müssten eigentlich als dritte Option „weiß nicht“ ankreuzen, sagt Vieluf, der zu dieser Frage empirische Studien durchführte. Doch wenn de Lehrer unsicher seien, zögen sie das Elternhaus mit ein, in der Erwartung, das „bildungsnahe“ Eltern eher die nötige Unterstützung für ein Kind am achtjährigen Gymnasium leisten könnten. So kommt es zwischen Klasse 4 und 5 verstärkt zur Trennung der Kinder nach Herkunft. Das kann die Forschung seit 40 Jahren mit Zahlen belegen.
In Hamburg zählt der Elternwille. Am Gymnasium hat jedes vierte Kind keine Empfehlung. Doch es müssen etliche diese Schulform verlassen. „Der Elternwille ist von unserer Verfassung gedeckt, eine verbindliche Aufteilung der Kinder durch den Staat verstößt gegen das Diskriminierungsverbot“, sagte am Mittwoch der Rechtswissenschaftler der Ruhr-Uni Bochum, Wolfram Cremer. Doch auch Hamburgs Praxis könnte rechtswidrig sein, wenn das Gesetz keine Schulformempfehlung vorsieht. „Ein Kind könnte klagen“, sagte Cremer. Die Schulbehörde sagt, sie teile diese Einschätzung nicht.
Wie sehr das Thema bewegt, wurde auf der Tagung deutlich. „Die Empfehlung kränkt die Kinder, macht ab Klasse 3 Unruhe in der Schule“, sagte eine Grundschulleiterin. Und eine Mutter schlug eine radikale Umbenennung beider Schulsäulen vor: „Warum sagen wir nicht Stadtteilgymnasium 8 und Stadtteilgymnasien 9?“ Heyenn will dem Schulsenator am 28. März möglichst viele Unterschriften übergeben und dann „hören, was er sagt“.





