(ÜBER)LEBEN IN BERLIN (Teil 14): "Rädchen der ganzen Gesellschaft"
In den vergangenen Monaten hat die taz insgesamt 13 Berlinerinnen und Berliner über ihren Joballtag befragt. Die Arbeitspsychologin Antje Ducki hat die Interviews gelesen. Die Aussagen zeigen, was nötig ist, damit ein Mensch mit seiner Arbeit zufrieden ist, sagt Ducki.
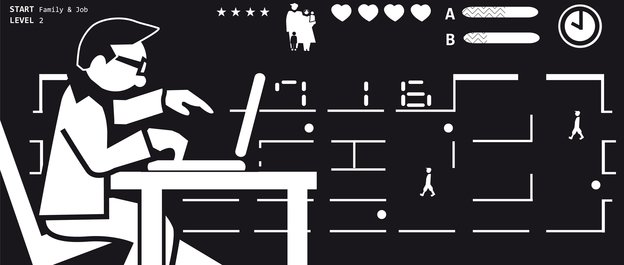
Programmierer bei der Arbeit. Bild: Illustration Eleonore Roedel
taz: Wie heißen Sie?
Antje Ducki: Ich heiße Antje Ducki.
Seit wann leben Sie in Berlin?
Seit 1981. Ich bin vor 31 Jahren zum Studium aus einer niedersächsischen Kleinstadt hierhergekommen.
Wo arbeiten Sie?
An der Beuth Hochschule für Technik Berlin, als Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie.
Wie sind Sie dazu gekommen?
Über einen ähnlichen Weg, wie ihn die Akademiker unter Ihren Interviewpartnern in der Arbeitsweltserie beschrieben haben: Ich habe lange in befristeten wissenschaftlichen Projekten gearbeitet und dann in Hamburg eine Assistentenstellen bekommen. Von dort aus habe ich mich auf Fachhochschulprofessuren beworben, weil ich vorher in der Praxis gearbeitet hatte und deshalb gerne angewandte Forschung machen wollte.
Die Arbeitswelt: Wie überlebt man in Berlin? Anders als anderswo, das ist klar. Es gibt kaum Industrie: 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in der Stadt werden mit Dienstleistungen generiert, weniger als 15 Prozent im produzierenden Gewerbe. Nur wenige Menschen haben hier das, was lange Zeit als Norm galt: einen festen, unbefristeten Job, ausreichend bezahlt, um überleben zu können. Rund 20 Prozent der Berliner leben von Sozialleistungen, weitere 20 werden von Familienangehörigen finanziert. Vollzeit arbeiteten laut Mikrozensus in der Stadt im Jahr 2010 gerade einmal 30 Prozent der 35- bis 40-Jährigen. In allen anderen Altersgruppen lagen die Werte teils weit darunter.
Das Problem: "Prekäre" Arbeit ist in Berlin mehr Norm als Ausnahme: Viele arbeiten Teilzeit oder in Minijobs. Das ist in gewissem Sinne fortschrittlich - nicht jeder möchte einem 40-Stunden-Job nachgehen. Problematisch ist dabei jedoch, dass die soziale Absicherung und die Teilhabe an der Gesellschaft in Deutschland wie in kaum einem anderen Land an das Beschäftigungsverhältnis gekoppelt sind.
Die Serie: Die taz dokumentierte in ihrer Sommerserie "(Über)Leben in Berlin", wie Berliner und Berlinerinnen arbeiten und wirtschaften. Jeweils mittwochs erschien ein Interview, geführt anhand eines standardisierten Fragenbogens, das den Alltag in einer bestimmten Branche abbildete. Mit dem heutigen Gespräch endet die Serie.
Würden Sie gern etwas anderes arbeiten?
Nein, ich bin extrem glücklich und zufrieden mit der Arbeit, die ich mache.
Sie haben ja auch einen unbefristeten Vertrag – im Gegensatz zu vielen unserer Interviewpartner der vergangenen Wochen.
Ja. Und Sie können sich nicht vorstellen, was für eine unglaubliche Erleichterung es war, diese Stelle als Professorin hier antreten zu können. Bis dahin hatte ich zwölf Jahre lang immer nur mit befristeten Verträgen gelebt. Den seelischen Druck, den ich vorher hatte, habe ich erst bemerkt, als ich den Vertrag für die Professur unterschrieben hatte – als der Druck abgefallen ist. Wie anstrengend eine Befristung für das eigene psychische Korsett ist, merkt man erst, wenn man in der Sicherheit angekommen ist.
In Berlin werden zahlreiche Arbeitnehmer nie mehr in dieser Sicherheit ankommen. Unbefristete Stellen werden ziemlich rar.
Das stimmt. Wir müssen uns klarmachen, was das für einen Menschen bedeutet, nämlich eine dauerhafte, latente Existenzangst und Unsicherheit. Wer nicht weiß, was morgen kommt, muss permanent das Umfeld scannen: Habe ich alles getan, sodass ich auch übermorgen noch einen Job, ein Projekt habe? Diese Daueraufmerksamkeit bringt ein erhöhtes Risiko für Burn-out mit sich. Deswegen gibt es bei vielen Menschen, die ein paar Jahre so gearbeitet haben, eine sehr große Sehnsucht nach Planbarkeit, Vorhersehbarkeit und Sicherheit.
In einem der Interviews sagt ein Computerspiele-Entwickler, dass er froh ist, nicht 40 Jahre lang denselben Weg ins immer gleiche Büro machen zu müssen.
In vielen Ihrer Gespräche wird sichtbar, dass die Freischaffenden ihre Flexibilität in der Lebensgestaltung als große Freiheit erleben. Da schwingt oft die Aussage mit: Ich bin froh, dass ich die Freiheit habe zu entscheiden, mit welchen Themen ich mich in meiner Arbeit beschäftige, wann ich arbeite und wann nicht. Dass niemand mir Vorschriften macht, niemand mich in meiner Bewegungsfreiheit eingrenzt und mir sagt: Heute ist Sonntag, und darum darfst du nicht arbeiten. Ich arbeite, wenn mir sonntags danach zumute ist. Dafür tue ich es dann eben am Montag nicht.
ist Arbeitspsychologin. Sie lehrt und forscht an der Berliner Beuth Hochschule für Technik im Stadtteil Wedding. Einer ihrer Schwerpunkte: Arbeitsanalyse und -gestaltung. Ducki arbeitet auch als Gutachterin für verschiedene Bundesministerien und die Senatsverwaltung für Inneres. Zudem ist sie Mitherausgeberin des "Fehlzeiten-Reports" des Wissenschaftlichen Instituts der AOK.
Aber viele arbeiten doch sowohl am Sonntag als auch am Montag und nehmen sich eben nicht frei.
Das ist die Herausforderung: Wer frei arbeitet, muss sich selbst begrenzen. Und sich darauf einstellen, bei seiner Arbeit häufig allein zu sein.
Hier gehen diesen Weg so viele wie nirgendwo sonst: Berlin hat bundesweit die höchste Selbstständigenquote.
Ja, und wir haben da jetzt mal ganz kurz durch das Schlüsselloch geguckt und die Welle gesehen, die auf uns zukommt: Die Zahl der Menschen, die allein unterwegs sind, um sich selbst und ihre Arbeitskraft zu verkaufen, wird in 20 Jahren noch weitaus höher liegen. Die Soloselbstständigkeit ist die Zukunft.
Warum scheitern schon jetzt so viele mit ihrer Selbstständigkeit?
Wer dabei erfolgreich sein will, braucht eine Kombination aus Risikobereitschaft und sehr, sehr hoher Selbstdisziplin. Diese Kombination ist nicht jedem gegeben. Und obwohl sich unsere Arbeitswelt so stark verändert, bilden wir an den Schulen und Hochschulen nicht hinreichend dafür aus. Wir müssen dort ganz andere Fähigkeiten entwickeln: sich selbst zu organisieren, sich selbst gut zu verkaufen.
Der Computerspiele-Entwickler kann sich sehr gut verkaufen: Er verdient 10.000 Euro im Monat. Trotzdem scheitert er ständig daran, seine Zeit richtig einzuteilen, und fühlt sich zwischen Arbeit und Familie zerrieben.
Unabhängig von der Qualifikation braucht in dieser neuen Arbeitswelt jeder ein gewisses Maß an Selbstdisziplin. Wer das nicht gelernt hat oder nicht lernen will, der hat es schwer.
Warum fällt es kreativ arbeitenden Menschen so schwer, um 18 Uhr Feierabend zu machen, ihr Büro zu verlassen und einfach abzuschalten?
Das funktioniert nicht, weil das Gehirn keine Maschine ist. Kreative Arbeit ist immer Arbeit, die fortgesetzt wird, auch wenn man Räume verlässt. Und viele haben ja nicht einmal mehr diese räumliche Grenze, sondern arbeiten von zu Hause aus. Wer sein Büro abschließen und ins Auto oder in die U-Bahn steigen muss, um nach Hause zu fahren, der lenkt seine Konzentration automatisch auf etwas anderes. Fällt das weg, wird es noch schwieriger.
Was können Kreativarbeiter tun?
Sie müssen sich ablenken und ganz bewusst anderen Tätigkeiten nachgehen. Nur so können sie sich Erholung und Entspannung verschaffen.
Da hat es ein Arbeiter leichter: Wenn Schicht ist, dann ist Schicht. Kaum einer war glücklicher mit seinem Job als der Industriemechaniker, mit dem wir gesprochen haben. Sind solche mechanischen Berufe denn besser geeignet, Zufriedenheit mit dem eigenen Tun herzustellen?
Nein, nicht per se! Ich wäre todunglücklich, wenn ich das machen müsste! Ich habe mal als Schülerin in einer Druckerei gejobbt, und mir war nach einer Woche klar: never ever! Um mit seiner Arbeit zufrieden zu sein, braucht es etwas anderes.
Was denn?
Eine hohe Übereinstimmung zwischen der Persönlichkeit eines Menschen, seinen Stärken und Wertevorstellungen, und der Tätigkeit, der er nachgeht. Das fand ich an allen Interviews so interessant: Es gibt keinen systematischen Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau und der Zufriedenheit mit dem Job. Ihren Job wechseln wollen Leute entweder, weil sie unter unwürdigen Bedingungen arbeiten müssen, wie der Dönerschneider mit einem Stundenlohn von 3,75 Euro. Oder weil sie in einem Bereich arbeiten, der nicht zu dem passt, was sie als Persönlichkeit ausmacht. Wenn Menschen aber ihre Fähigkeiten ausleben können und irgendwie das Gefühl haben, das, was sie machen, sei sinnvoll, dann sind sie glücklich.
Die Krankenschwester, die in der ambulanten Altenpflege arbeitet, hält das, was sie tut, zu Recht für sinnvoll. Trotzdem muss sie sich von anderen fragen lassen: „Machst du diesen Job freiwillig?“
Jeder Beruf hat in unserer Welt einen Wert. Pflege brauchen alle, wenn sie irgendwann nicht mehr können. Pflegeberufe sind aber unglaublich schlecht bezahlt. Und über die Bezahlung definiert sich tatsächlich der soziale Status eines Berufs. Außerdem wissen viele Menschen, wie hart und anspruchsvoll dieser Beruf ist, welch hohen emotionalen Anforderungen er mit sich bringt und dass sie selbst das nie leisten könnten.
Berlins Arbeitssenatorin Dilek Kolat (SPD) hat gerade erst mehr Anerkennung für Pflegeberufe gefordert. Ist ein solcher Appell nicht nur Schall und Rauch?
Das muss nicht sein. Politik kann mit Aufklärung, Werbung und aktiver Imagegestaltung viel Einfluss nehmen. Was haben wir in dieser Stadt für Kampagnen erlebt! Als bestes Beispiel für die Aufwertung einer Arbeit, die früher total abgewertet war, nenne ich meinen Studenten immer die Kampagne der Berliner Stadtreinigung für die Straßen- und Gehwegreiniger: Die ist witzig, humorvoll, total gut. Wenn ich heute meine Studenten nach dem Image der Stadtreinigung frage, dann sagen die: cool! Berlins Studenten haben solch ein Bild von Berlins Stadtreinigung: Das ist doch super!
Ein gutes Image ändert aber nichts an der miesen Bezahlung eines Pflegejobs.
Natürlich nicht. Mit einem guten Image lässt sich viel erreichen, aber vor allem braucht es eine bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. Doch häufig sind Pflegetätigkeiten einfach so körperlich und seelisch beanspruchend, dass es nicht sinnvoll ist, sein ganzes Erwerbsleben damit zu verbringen. Es gibt Berufe, die kann man nicht bis zur Rente machen. Da muss man entweder den Job oder die Tätigkeit innerhalb des Jobs wechseln.
Ein Leben ohne Arbeit konnte sich keiner unserer Gesprächspartner wirklich vorstellen.
Das hat damit zu tun, dass Arbeit viele unterschiedliche Funktionen in der Gesellschaft hat: Sie bindet uns in den Wertekanon ein, sie macht uns zu einem Rädchen der ganzen Gesellschaft, sie gibt uns Struktur, vor allem zeitlich. Lesen Sie nur einmal Lebensberichte von Arbeitslosen, denen diese Zeitstruktur genommen wird! Und Arbeit sorgt eben auch dafür, dass wir sozial eingebunden sind. Eine Alternative zur Erwerbsarbeit haben wir bislang nicht wirklich gut hinbekommen.
Obwohl es vielen mit ihrer Arbeit so geht wie dem Kita-Erzieher, den wir interviewt haben: Burn-out, Belastungsstörung, chronische Rückenschmerzen, Tinnitus, drei Monate Tagesklinik.
Ja, wobei ich an dessen Geschichte etwas sehr spannend fand: Der wollte ja raus aus seinem Job. Und dann bekam er plötzlich ein Jobangebot über die Arbeitsagentur …
… und ist deshalb fürchterlich erschrocken …
… und trotzdem zu der neuen Kita hingegangen. Heute arbeitet er dort und ist total glücklich. Es mag vielleicht zynisch klingen, aber diesen Mann hat die Arbeitstätigkeit wohl wieder gesund gemacht. Er hat gelernt, anders mit sich umzugehen. Und er ist offensichtlich in einem Rahmen gelandet, der es zulässt, dass er es ein bisschen vorsichtiger angehen lässt, weniger Stunden arbeitet, guten Kontakt mit den Kindern und Eltern hat und sich gleich freinehmen kann, wenn es ihm nicht gut geht. Es ist ein gutes Zeichen, dass Leute nach solch einer Krise in ihrem Job verbleiben können, ohne sich so überfordern zu müssen wie vorher. Denn da gibt es etwas, das uns in dieser neuen Arbeitswelt abhandenkommt.
Was?
Solidarität. Diese Entwicklung ist total ungut: Arbeitsverhältnisse, in denen jeder sein eigener Herr ist, sind entsolidarisierte Arbeitsverhältnisse. Für den Einzelnen wird es unglaublich schwierig zu erkennen, wofür er selbst und wofür die Gesellschaft verantwortlich ist.
Alle unsere Interviewpartner haben wir gefragt, wo sie sich in zehn Jahren sehen – und alle haben optimistisch geantwortet. Wenn wir weiter gefragt haben, wer denn dafür verantwortlich ist, was in zehn Jahren sein wird, dann haben alle, meist ohne zu zögern, geantwortet: ich selbst.
Wir haben es verinnerlicht. Der Soziologe Alain Ehrenberg hat das perfekt beschrieben: Wir leben heute in einer Welt, in der die Verantwortung für das Scheitern in das Individuum zurückverlegt ist. Unsere Welt suggeriert uns, alles wäre möglich. Alles geht, du musst es nur anpacken. Und wenn du es nicht schaffst: Pech gehabt! Dann ist es eben dein Problem. Davon zeugen viele Krankheitsentwicklungen.
Inwiefern?
In der Psychologie nennen wir das „interessierte Selbstgefährdung“: Gerade Selbstständige haben eine hohe Identifikation mit ihrem Job und wissen, sie sind eigenverantwortlich für das, was geschieht oder nicht geschieht. Aus dieser Eigenverantwortlichkeit heraus neigen viele dazu, sich selbst kontinuierlich zu überfordern, weil sie die Marktgesetze so weit verinnerlicht haben, dass ihre Psyche nach den Gesetzmäßigkeiten des Marktes tickt: Wenn ich jetzt die Chance auf ein Projekt habe, dann muss ich es jetzt durchziehen – ganz egal, was es mich kostet oder ob meine Konstitution das gerade zulässt. Denn ich weiß ja nicht, was in zwei oder drei Jahren ist. Gegen derartige Überforderung hilft auch ein bisschen Yoga nicht.
Was hilft dann?
Zum einen müssen wir jungen Menschen schon in den Schulen Schutzmechanismen beibringen: „Du bist nicht schuld für das Scheitern in einer Welt, die nur so tut, als wäre alles möglich!“ Und zum anderen müssen wir gesamtgesellschaftlich nach neuen Organisationsformen für das Erleben von Solidarität suchen.
Was ist mit den Gewerkschaften?
Gewerkschaften laborieren an einem Demografieproblem: Wer macht da für wen Politik, und wie alt sind diese Verantwortlichen? Junge Menschen fühlen sich davon oft nicht angesprochen, weil sie diesen atypischen Beschäftigungsverhältnissen noch mit so einem jugendlichen Gefühl der Kraft begegnen: Egal, wie widrig die Bedingungen sind, ich schaffe das. Das bedient diesen Freiheitswunsch, dieses Freiheitsempfinden. Und das ändert sich erst, wenn sie es einmal nicht allein geschafft haben, wenn sie schmerzliche Erfahrungen von existenziellem Ausmaß gemacht haben.
Dann ist es womöglich schon zu spät.
Ich glaube, Solidarität entsteht heute auch schon auf vielen Wegen, ein Weg davon ist das Engagement in Gewerkschaften. Individuen suchen ihre sozialen Bezüge vielfältig, über Wohngemeinschaften, über gemeinsames Kochen, über die Liebe zum Buch.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Denken Sie an den Verleger, der sich im Börsenverein des Deutschen Buchhandels engagiert, zum Beispiel für die Leseförderung! Das ist vielleicht eine stärker inhaltlich interessengeleitete Form von Solidarität, aber auch Solidarität funktioniert einfach nicht mehr so wie noch vor 20 oder 30 Jahren. Und gerade Berlin hat da echte Chancen.
Was meinen Sie?
Wir haben dieses Menschenspektrum, das hier arbeitet: jung, kreativ, tendenziell arm, kulturell total breit aufgestellt. Das bedeutet eine große Chance, hier eben andere Formen von Solidarität auszuprobieren. Wie unsere Hochschule hier mitten im Wedding, mitten in mitunter schwierigen sozialen Strukturen: Wir haben hier viele junge Studierende, die kommen direkt aus der Nachbarschaft. Wir sind eine Kiez-Hochschule. Das heißt, wir leisten einen Beitrag, die Bildungsstruktur in dieser Gegend positiv weiterzuentwickeln. Es erstaunt nicht sonderlich, wenn ich als Hochschullehrerin das jetzt sage: Aber inmitten all dieser Veränderungen der Arbeits-, inmitten all dieser Gentrifizierungsprozesse ist Bildung der wesentliche Beitrag zu einer positiven Zukunftsentwicklung. Nur wer Bildung hat, hat die Möglichkeit zur freien Wahl.

Leser*innenkommentare
yberg
Gast
oh gott,die wissenschaft und die aufwertung der straßen- und handreiniger bei der berliner stadtreinigung
die studierte dame sollte sich eher gedanken darüber machen inwieweit die mittlerweile zigmillionen kampagne des monopolisten unter politischer protektion BSR es geschafft hat,immer weniger leistung ,ich erinnere an den einen und andern winter,an immer geringere reinigungfrequenzen auch in innenstadtbezirken,an die ungenügende reinigungsleistung der strieder bomber-kleine kehrmaschienen die auf dauer die gehsteigplatten verschieben und kaputtfahren und ebenso das mosaik pflaster deformieren und verwirbeln-für die verwahrlosung des öffentlichen raums mit pate stehen.
die angebliche aufwertung der beschäftigten mag im elfenbeinturm angekommen sein,auf welche weise auch immer,aber im richtigen leben werden diese beschäftigten immer noch als bequeme verlierer in der statushirarchie verläßlich ganz unten eingeordnet.
die wissenschaftsdame sollte mal einen zusammenhang herstellen zwischen der zunehmenden vermüllung des öffentlichen raums und den vermeintlich aufgewerteten beschäftigten.
wäre die kampagne auch nur im ansatz erfolgreich und würde diese zudem noch verständnis für die arbeitswelt der betreffenden schaffen,würde sich dies auf jeden fall im verhältnis öffentlicher raum und geringerem müllaufkommen abzeichnen.
ein versprechen bleibt auch diese neckische mit worten spielende imagekampagne,die sich schon lange totgelaufen hat und sich nun durch die nichteinhaltund des versprechens in ihr gegenteil kehrt und nichtleistung deutlicher vermittelt
noch erbärmlicher wäre es,wie schon gelesen ,wenn die führungskräfte und personalverantwortlichen tatsächlich auf diesem wege ihre mitarbeiter erreichen, ansprechen und wertschätzen wollen