Russische Sprache in der Ukraine: Verständlich, aber unklug
Russisch soll in der Ukraine seinen Schutzstatus verlieren. Der Schritt könnte angesichts der vielen Russischsprachigen im Land nach hinten losgehen.

W er verstünde nicht, dass viele Ukrainer*innen nach knapp 1.400 Tagen vollumfänglicher russischer Invasion mit Abscheu, ja abgrundtiefem Hass reagieren, wenn sie die Sprache des Aggressors hören. Doch ob ein Gesetzentwurf der Regierung, der seit Kurzem dem Parlament vorliegt, eine politisch kluge Entscheidung ist, darf bezweifelt werden.
Dem Vorschlag zufolge, der bereits im Dezember vergangenen Jahres auf dem Tisch lag, soll das Russische in der Ukraine von der Liste besonders zu schützender Minderheitensprachen gestrichen werden. Dem steht jedoch die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen des Europarates entgegen, die in der Ukraine seit dem 1. Januar 2006 in Kraft ist. Und nicht nur das: Auch Artikel 10 der ukrainischen Verfassung stellt die russische Sprache – neben anderen – explizit unter den Schutz des Staates.
Es ist nicht das erste Mal, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine Regierung etwas zu kreativ mit ihren Rechtsgrundsätzen umgehen. Erinnert sei an den Versuch, im Sommer zwei Antikorruptionsbehörden auf Linie zu bringen. Das Vorhaben scheiterte. Auch der jetzige Verstoß ist juristisch anfechtbar, wirft jedoch noch andere Fragen auf.

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.
Das gilt umso mehr, als Sprache in der Ukraine ein Politikum und seit dem 24. Februar 2022 umstrittener ist denn je. Auch wenn viele etwas anderes behaupten: Es ist nicht willkommen, aber keineswegs verboten, in der Ukraine Russisch zu sprechen. Diskriminierung mag es geben, aber sie ist kein Massenphänomen. Russisch ist die Muttersprache jedes dritten Ukrainers, jeder dritten Ukrainerin. Von ihnen steht ein Großteil für das Land ein.
Warum die Regierung gerade jetzt Handlungsbedarf sieht, erschließt sich nicht. Die Initiative könnte zudem nach hinten los gehen: Die Gesellschaft dürfte weiter polarisiert werden, der Kreml bekommt eine weitere Steilvorlage für seine Propaganda. Braucht die Ukraine das? Nein, es gibt weitaus wichtigere Probleme: Der nächste Winter steht vor der Tür.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





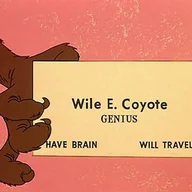



meistkommentiert