Autorin über Mütter und Sex: „Die MILF ist ein Markt“
Katja Grach über ihr Buch „Die MILF-Mädchenrechnung“ und die Frage, wie aus der „Mom I’d like to fuck“ ein Subjekt werden kann.

Niedlich, aber nicht förderlich für das Sexualleben ihrer Eltern: Drillinge in Hessen Foto: dpa
taz: Frau Grach, Sie schreiben von der „Dreifaltigkeit der MILF“: Porno, Popkultur und Real-Life-Mütter. Wie hängen diese drei Begriffe miteinander zusammen? Und was bedeutet MILF eigentlich genau?
Katja Grach: Die Definition MILF, die „Mom I’d like to fuck“, wurde in den 1990er Jahren durch die Teenie-Komödie „American Pie“ populär. Der Begriff hat sich dann ab Mitte der 2000er Jahre in der Mainstream-Pornografie etabliert und blieb gleichzeitig auch in der Popkultur hängen. Prominente Mütter werden damit betitelt – oder tun es selbst, um ihre Sexyness auch nach der Geburt ihres ersten Kindes zu unterstreichen. Da kommen dann die „Real-Life-Mütter“ ins Spiel. Die Erwartungshaltung, dass ein Frauenkörper bestimmten Schönheitskriterien zu entsprechen hat, gilt mittlerweile auch im Kreißsaal. Dabei geht es nicht nur um Schönheit, sondern sehr stark um die sexuelle Attraktivität, die sogenannte „Fuckability“.
Frauen sind ja diesen Ansprüchen rund um ihr Äußeres immer ausgesetzt. Was ist das Spezielle an Müttern?
Die Mutter galt sehr lange als asexuelles Wesen. Heilige und Hure standen sich gegenüber, die Mutter war die Heilige. Medial hat sich das in den vergangenen zwanzig Jahren geändert. Die Zuschreibungen für Frauen in Bezug auf ihre Attraktivität hat es schon immer gegeben. Aber es ist auffällig, dass diese mittlerweile sehr viel stärker in Bezug auf Mütter verhandelt werden. Die MILF vereint die Assoziationen von Heiliger und Hure.
Woher kommt dieses Phänomen?
Die MILF ist ein Markt. Mit dem neoliberalen Zeitalter und der Marktwirtschaft, die sich auf Geschlechterrollen und Klischees stürzt, werden Mütter als Zielgruppe neu erschlossen. Die Körper von Frauen verändern sich durch Schwangerschaften, und die Schönheitsindustrie macht Geld mit den körperlichen Unsicherheiten der Frauen. Es gibt Fitnessprogramme, die sich „MILF-Maker“ nennen.
Das heißt, in der Werbung wird mit der Selbstbestimmung der Frau gespielt, die aber eigentlich nur eine Marionette der Werbung ist?
Genau. „MILF“ ist seit zehn Jahren das beliebteste Pornogenre. Die Kombination von Mutter und Sexualität ist ein reizvolles Tabu. Möglicherweise ist auch ein bisschen „Mama wird’s schon richten“ oder eine Sehnsucht nach einer Führung, bei der sich der Mann fallen lassen kann, mit in dieser Fantasie verwoben. Vielleicht ist der MILF-Hype im Porno auch nur die andere Seite der Medaille von „Fifty Shades of Grey“. Aber das ist ein Wild Guess, der sicher genauer betrachtet gehört.
Katja Grach

Foto: Verlag
Jahrgang 1983, lebt in Graz und arbeitet als Sexualpädagogin. Sie bloggt über Elternschaft, Sex und Geschlechter.
In Ihrem Buch stellen Sie andere Mütterbilder vor. Gibt es Vorbilder?
Ich spreche vermeintliche „schlechte“ Vorbilder an, also jene, die historisch als Huren gebrandmarkt wurden, weil sie sexuell selbstbestimmt leben wollten. Dabei taucht einerseits Lilith, die erste Frau Adams, auf. In der feministischen Theologie wird sie als Ikone gehandelt. Auch die Amazonen werden besonders popkulturell immer wieder als emanzipatorische Vorbilder verarbeitet – wie zuletzt in „Wonder Woman“. Die Crux an der Sache ist, dass diese alten Vorbilder in den Geschichten immer wieder für ihr Verhalten bestraft wurden – mit Wahnsinn, Tod, Verbannung. Amazonen wurden besonders gern „umgestimmt“, um sich wieder in ein heteronormatives Weltbild einzufügen. Meine Alternative wären deshalb eher vielfältige Lebensweisen, die nebeneinander friedlich koexistieren, anstatt eines Ideals, das unerreichbar scheint.
Wäre eine MILF überhaupt möglich außerhalb unserer heteronormativen Welt?
Der Begriff ist stark an einen weißen, heteronormativen und patriarchalen Kontext geknüpft. Kultureller Background und die ökonomische Ausgangssituation spielen ebenfalls eine Rolle. Die MILF ist nur denkbar in einem Umfeld, wenn sie ein Tabubruch ist. Dieser fehlt zum Beispiel bei einer Teeniemutter, weil Sexualität und Jugend ohnehin zusammengedacht werden. Oder bei einer lesbischen Mutter, weil Geschlechterhierarchie kein Thema ist.
Frauen werden – meistens – durch Sex Mütter. Und sind dann aber keine sexuellen Wesen? Das ist doch Paradox.
Ja, das ist recht spannend in unserem Kulturkreis. Da greift eben die Kultur- und Religionsgeschichte ganz stark. Niemand möchte außerdem über den Sex der eigenen Eltern nachdenken. Gleichzeitig ist es ein Thema unter frischgebackenen Eltern: Hat man überhaupt noch welchen und, wenn ja, wie oft?
Ändern sich denn sexuelle Bedürfnisse nach einer Geburt?
Die Bedürfnisse eines Menschen als sexuelles Wesen bleiben die gleichen. Unsere sexuelle Biografie, unsere Sozialisation ist ja nicht weggewischt dadurch, dass jemand ein Kind zur Welt gebracht hat. Aber die Zeit, die zur Verfügung steht, ist natürlich weniger. Die Energiereserven sind andere. Damit müssen Eltern erst mal klarkommen. Paradoxerweise finden sich in Elternratgebern für die ersten Jahre mit Baby nirgendwo Hinweise für die Stärkung und Aufrechterhaltung ihrer Beziehung und ihrer Sexualität. Gleichzeitig wird der Kontext Elternschaft in Beziehungs- und Sexratgebern oft ausgelassen. Eigentlich ist das grob fahrlässig für all die Ansprüche, die wir heute an Partnerschaft stellen. Das Einzige, das ständig überall verhandelt wird, ist, wie Frauen für Männer sexuell attraktiv sein können, was sie draufhaben sollten, um ihren sexuellen Marktwert zu steigern. Als ob Eltern keine anderen Sorgen hätten.
Sie beschreiben, wie viel Arbeit die Fuckability für Frauen bedeutet. Während Männer unbearbeitete Dickpics verschicken. Woran liegt das?
Es liegt an patriarchalen Gesellschaftsstrukturen, in denen Frauen Objekte und Männer Subjekte sind. Als Subjekt muss ich niemandem gefallen wollen. Entweder nimmt man mich, wie ich bin, oder nicht. Als Objekt stehe ich immer in Konkurrenz, und deshalb tu ich mir die Arbeit an. Das hat mit Hierarchien zu tun. An Orten, die hierarchisch organisiert sind, gibt es viel Konkurrenz. Konkurrenz bedeutet, dass ich mich mit anderen messen muss. Wenn ich am oberen Ende der Hierarchie sitze, muss ich nichts leisten.
Dann kann ich einfach ein Dickpic verschicken.
Genau, und dabei denken: „Deal with it“.
Wie können Frauen vom Objekt zum Subjekt werden?
Grundsätzlich sind wir natürlich alle Subjekte. Aber für die Öffentlichkeit braucht es Sichtbarkeit bis an die Schmerzgrenze und damit verbunden eine Portion Präpotenz, um einen Objektstatus zu überwinden. Wir sehen überall an öffentlichen Plätzen Penisse auf Wände geschmiert. Vielleicht sollten wir anfangen, parallel anatomisch korrekte Vulven an Bushaltestellen zu schmieren oder uns als Frauen einfach mal zugestehen, mehr Raum einzunehmen. Und das kann schon damit beginnen, sich nicht damit zu quälen, welches Outfit den heute geblähten Bauch am besten kaschiert, sondern der Welt einfach diese Normalität des menschlichen Körpers zuzumuten. Genauso wie ein paar Härchen am Bein, anstatt bei 32 Grad in Leggings zu schwitzen. Vielfalt und Normalisierung erreichen wir nur, wenn wir vermeintliche Tabus vor den Vorhang holen und uns selbst zu handelnden Subjekten machen.
Wenn wir utopisch denken: Wir leben in einer Welt, in der es die Kategorien Subjekt und Objekt nicht mehr gibt. Wie sähe unsere Sexualität aus?
Wir wären sehr viel freier und hätten weniger Diskussionen darüber, was Konsens ist. Dazu viele unaufgeregte Gespräche darüber, wo unsere Grenzen liegen. Uns würde es leichter fallen zu akzeptieren, dass Menschen unterschiedlich sind und Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Wir könnten menschliche Vielfalt besser akzeptieren. Wir würden weniger Ängste entwickeln, die auf Mythen beruhen. Pornografie würde zurückgedrängt werden, weil es weniger Tabus gäbe. Erotik und Sinnlichkeit wären dafür präsenter. Sexualität wäre positiver besetzt und hätte weniger mit potenziellen Gefahren zu tun.
Sie appellieren an die Überwindung von der MILF zur Fuckermother. Was meinen Sie damit?
Den Begriff habe ich von einem feministischen Blog der Historikerin Lisa Malisch. Sie stellt sich Fuckermothers als Menschen vor, die sich weigern, einem unerreichbaren Ideal nachzulaufen. Je fehlerfreundlicher wir zu uns selbst sind, desto weniger Stress werden wir haben, desto gelassener werden wir. Und das tut uns und unserer Sexualität gut.



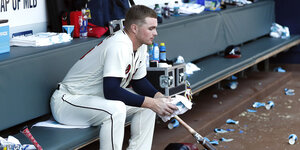

Leser*innenkommentare
jhwh
Ziemlich daneben fürchte ich.
MILF ist ein "popularisierter Ausdruck für attraktive Frauen mittleren Alters, im 4. und 5. Lebensjahrzehnt, die aus der Sicht junger, aber auch älterer Männer und Frauen eine attraktive Sexualpartnerin darstellen."
(Wikipedia)
Von Kindern ist nicht die Rede. Außer im ersten Wort der hinter dem Akronym stehenden Bezeichnung ("Mother"). Das liegt aber wohl eher daran, daß in den USA eine kinderlose Frau über 30 die Ausnahme ist. Konsquenterweise werden Männer im gleichen Alter "DILFs" (Daddy, ...) und noch ältere Frauen GILFs (Granny, ...) genannt.
Was das Objekt- bzw. Subjektsein angeht, denke ich, daß wir zivilisatorisch an einem Punkt angelangt sind, an dem jede/r selbst über ihre/seine Rolle entscheiden kann.
Und ab da gilt ... form follows function :)
Age Krüger
Hm, irritierend finde ich jetzt, dass in meiner Umgebung immer ausreichend Frauen waren, die eigentlich ein gesetztes Alter hatten und auch Kinder hatten und sich mit ihren 90 kg bei 1,60 m irgendwie nie störten, ob der Mann sie noch attraktiv fand. Der sah auch nicht anders aus.
Irgendwie habe ich solche Frauen in meiner Umgebung immer eher als Regel und somit in der Mehrheit empfunden anstatt irgendwelche Damen, die sich nach der Hochzeit sich noch Sorgen um ihr Äußeres machten. Ich höre und lese nur immer davon.Aber es gibt imo massenhaft Frauen, die sich nicht in die "Attraktivitätsfalle" haben locken lassen.
Vielleicht kommen die nicht aus der richtigen Schicht, um interessant zu sein.
95823 (Profil gelöscht)
Gast
die Autorin übersieht das sich die Begriffsbedeutung in den letzten Jahren leicht geändert hat, korrekterweise müsste es heute eigentlich heißen "Mature I'd like to fuck".
Vidocq
So unverkrampfte Betrachtungen zur Sexualität hätte ich mir für die 70er gewünscht, als eine verkorkste Mutter ihre verstörende Erfahrungswelt in meine Pubertät drängte.
Um so beruhigender, befriedender, dass nach der sogenannten sexuellen Befreiung Perspektiven einer tatsächlichen absehbar erscheinen.
Auf jeden Fall sind mir Frauen mit Geschichte an Haut und Leib anziehender als die Langweiler aus der Model-Retorte...
Marc T.
Frauen dürfen ruhig entspannt ihrem Aussehen gegenüber sein.
Meiner Ansicht nach muss sich Frau schon sehr viel Mühe geben ihre Fuckability zu verlieren.
pitpit pat
"Während Männer unbearbeitete Dickpics verschicken. Woran liegt das?"
Das liegt daran, dass Männer glauben, 'form follows function' sei nicht nur die universelle Antwort auf jedes Gestaltungsproblem, sondern gleichzeitig auch in ihrer sozialspychologischen DNA eingeschrieben: Männer müssen nichts Schönes machen, Männer müssen einfach machen. ('Weib! Ich bin nicht hier, damit du mir sagst, dass ich gut aussehe; denn ich weiß gar nicht wie das geht. Sag mir, dass deine Knie weich werden, wenn ich wild vor dir stehe.')
Wer sich zuviele Gedanken über das Aussehen von etwas macht, übt Verrat am eigenen Geschlecht - dann könnten das ja alle Männer machen!
88181 (Profil gelöscht)
Gast
@pitpit pat Ich wüsste gar nicht, wie ich meine Dickpics bearbeiten sollte.....
pitpit pat
@88181 (Profil gelöscht) Denken Sie an "Das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit" und lassen Sie es.
Age Krüger
Ich weiß nicht mal, was das ist.
MILF habe ich noch gefunden.
pitpit pat
@pitpit pat Immerhin, in kleinen Schritten geht es vorwärts: http://critiquemydickpic.tumblr.com/
El-ahrairah
Fuckability der alleinerziehenden Hedonismusopfer. Autistische Selbstvermarktung bei abnehmendem Attraktivitätskurs. In ein paar Jahren kommt eh der Rollback, importiert oder homegrown, und räumt das ganze Rumgekrampfe ab.
Kommentar bearbeitet. Bitte beachten Sie unsere Netiquette.
Die Moderation
El-ahrairah
@El-ahrairah Nabokov hat die Nettiquette auch nicht gelesen...
Alkibraut
Interssant wie metaphysisch sich hier die Welt zurecht interpretiert wird. Hauptsache Patriachat, hetero und weiss tragen irgendeine diffuse Schuld. Welche Motive junge Männer in Bezug auf MILFs tatsächlich hegen, interessiert nicht. Man weiss es ja eh besser. Für mich jedenfalls liegt der Reiz einfach in der Attraktivität der Frau, und nicht irgendein Tabu, und es gibt eben verdankt attraktive Mütter. Außerdem wird völlig ignoriert, dass Männer auch Druck ausgesetzt sind, zu gefallen. Die Penisbilder sind ne absolute Randerscheinung.
Willi Müller alias Jupp Schmitz
EVRY-BODY is fuckable. Der Wandel vom Objekt zum Subjekt und zurück.
Will ich jemand ficken? NEIN
Will ich mit jemand ficken? JA
Alternative Autosex. Beim Wichsen kann ich meiner Phantasie freien Lauf lassen, brauche keine Pornos, entdecke täglich meinen Körper neu und trete niemand auf den Schlips.
Wenn es dann mal mit jemand anderem klappt (Wichsen oder und Ficken), männlich, weiblich, queer - auch nicht schlecht.
Olo Hans
@Willi Müller alias Jupp Schmitz keine Details!
Frau Kirschgrün
@Olo Hans Na sehn 'Se, sogar dafür zu verklemmt… ----- Was sagen Sie denn erst wenn Frauen mal richtig deutlich werden? ------------------ Danke für die offenen Worte von W M ----------------- Offene Worte meinerseits erspar' ich mir, hab' keine Lust auf Häme, aber es gehörte OFFEN diskutiert, OLO HANS.