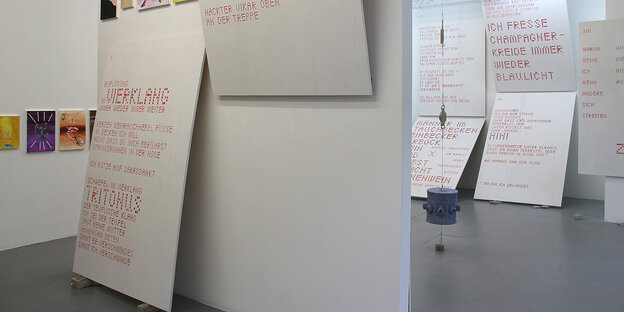Kinotipp der Woche: Kein Denkmal
Mit „Fassbinder. Tausende von Spiegeln“ liefert Ian Penman weit mehr als die Werkbiografie eines großen Regisseurs der deutschen Nachkriegszeit.

„Angst essen Seele auf“ (1974), Regie: Rainer Werner Fassbinder Foto: Rainer Werner Fassbinder Foundation
Mitte Februar ist ein Projket realisiert worden, das schon vor 40 Jahren in Planung war. Der britische Musikjournalist Ian Penman hat sich während der Pandemie doch noch an ein Buch über Rainer Werner Fassbinder gewagt, so wie er es kurz nach dessen Tod 1982 schon geplant hatte.
In 450 kurzen und kürzeren Einträgen umkreist Penman in „Fassbinder. Tausende von Spiegeln“ Aspekte von Fassbinders Leben und Werk – und sich selbst. Penmans siebter Eintrag in seinem Buch lautet „Warum genau hat man ihn, dem Himmel sei Dank, nicht zum Denkmal gemacht?“ Der achte: „Warum genau entehrt es ihn so, dass man ihn nicht zum Denkmal gemacht hat?“.
Penman hat – wie Ekkehard Knörer in seiner Rezension schrieb – ein Buch geschrieben, „das sich allen Genres entzieht“. „Fassbinder. Tausende von Spiegeln“ ist keine Werkbiografie, sondern eher eine umkreisende Reflexion über Fassbinder und sein Werk.
Am Samstag ist die Neuerscheinung dem Lichtblick-Kino Anlass für einen Fassbinder-Abend. Gezeigt wird „Angst essen Seele auf“ (1974) und nach dem Film stellt Robin Detje, der die Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche geleistet hat, das Buch vor. Für einen Abend in unhagiographischer Auseinandersetzung mit Fassbinder ist das eine sehr gute Kombination.
Ian Penman: Fassbinder. Tausende von Spiegeln, deutsch von Robin Detje, Berlin 2024;Buchpräsentation und Sondervorstellung „Angst essen Seele auf“: 9. 3., 18 Uhr, Lichtblick-Kino; Stream zu Viola Shafiks „Ali im Paradies“ auf der Website des Verleih mec film
Anfang der 1970er Jahre sieht Fassbinder sechs Filme von Douglas Sirk, der 1937 vor den Deutschen in die USA geflohen ist. In dem Essay, der aus dieser Begegnung entsteht schreibt er, es seien die schönsten Filme der Welt darunter gewesen. Die Begegnung mit Sirks Filmen gilt als prägend für die Entstehungsgeschichte von „Angst essen Seele auf“.
In der Form eines Melodramas erzählt Fassbinder darin von der Begegnung zweier einsamer Menschen: der etwa 60jährigen Putzfrau und Witwe Emmi (Brigitte Mira) und des 20 Jahre jüngeren Arbeiters aus Marokko, Ali (El Hedi ben Salem). Zwischen den beiden entwickelt sich eine zarte Liebe, auf die Emmis Umfeld mit Rassismus reagiert.
Der taz plan erscheint auf taz.de/tazplan und immer Mittwochs und Freitags in der Printausgabe der taz.
„Angst essen Seele auf“ entfaltet entlang der Liebesgeschichte ein komplexes Gesellschaftsbild der Bundesrepublik der 1970er Jahre, jener Einwanderungsrepublik, die keine sein wollte. Nach seiner Uraufführung 1974 wurde der Film schnell zu einem der erfolgreichsten Filme Fassbinders, lief noch im selben Jahr auf den Filmfestivals in Cannes und Chicago.
2011 widmete die Filmwissenschaftlerin Viola Shafik Fassbinders Hauptdarsteller einen Dokumentarfilm, in dem sie eine beeindruckende Mischung aus Desinteresse an und exotisierenden Projektionen auf El Hedi Ben Salem M’barek Mohammed Mustafa seitens Fassbinders und Teilen seiner Filmcrew feststellt. „Ali im Paradies“ kratzt deutlich an dem antirassistischen Nimbus, der „Angst essen Seele auf“ bis heute umgibt.
Dass das Lichtblick-Kino mit „Angst essen Seele auf“ zur Präsentation von Penmans neuem Buch über Fassbinder dessen bekanntesten, aber in mancher Hinsicht auch durchaus ambivalenten, Film zeigt, ist ein guter Ausgangspunkt für eine würdigende, aber zugleich auch kritische Auseinandersetzung mit Fassbinder als einem der interessantesten Regisseure der deutschen Nachkriegszeit.