
In Torgau soll eine Ausstellung an die Opfer der NS-Militärjustiz erinnern. Für sie gibt es noch immer zu wenig Aufmerksamkeit und Anerkennung.

Ludwig Baumann desertierte 1942 aus der Wehrmacht, wurde verurteilt und kämpfte ein Leben lang für seine Rehabilitation. Nun gibt es einen Film über ihn.

Auf dem Grundstück der „Topographie des Terrors“ befand sich auch ein Hausgefängnis der Gestapo. Eine neue Ausstellung beschäftigt sich damit.

Gabriel Bach floh als Kind vor den Nazis und war 1961 Generalstaatsanwalt im Prozess gegen Adolf Eichmann. 94-jährig verstarb Bach nun in Jerusalem.

Durch Zufall erfuhr der Fotograf Stefan Weger, dass seine Urgroßmutter einen polnischen Zwangsarbeiter an die Nazi-Justiz ausgeliefert hat.

Ludwig Baumann desertierte 1941 von einem Marinestützpunkt in Frankreich. Nun wird in der Jenfelder Au eine Grünfläche nach ihm benannt.

Reihenweise NSDAP-Mitglieder: Eine Studie attestiert der Bundesanwaltschaft in den Nachkriegsjahren einen fehlenden Bruch mit der NS-Zeit.

Der Prozess um die Tötung von Tausenden Häftlingen im KZ Sachsenhausen zieht sich: Der Angeklagte muss zu einer Behandlung ins Krankenhaus.

Das „Strafgefängnis Wolfenbüttel“ war eine der Hinrichtungsstätten der Nationalsozialisten im Norden. Nun gibt es dort ein Dokumentationszentrum.

Hermann Stieve experimentierte mit Menschen, die von der NS-Justiz zum Tod verurteilt wurden. Ihre Gewebeproben werden nun bestattet.
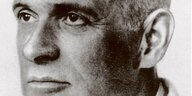
Jens Rommel von der Zentralen Stelle für die Verfolgung von NS-Verbrechen über das Problem des zunehmenden zeitlichen Abstands.

David W. wartet in U-Haft auf seinen Prozess in Hamburg. Am Verhandlungstag klagt er über Durchfall, doch der Richter bleibt hart.

Wie viele alte Nazis waren in der Berliner Justiz nach 1945 tätig – und mit welchen Folgen? Ein Forschungsprojekt von FU und HU soll das jetzt klären.

Am 1. August 1933 ließ die nationalsozialistische Justiz in Altona bei Hamburg ihre ersten Opfer hinrichten: ein Racheakt.

„Wir wollten einfach leben“, sagte Wehrmachtsdeserteur Ludwig Baumann. Der Friedensaktivist starb am 5. Juli 2018. Am Mittwoch wird ihm in Bremen gedacht.

Die Marine ehrt einen Konteradmiral, der kurz vor Kriegsende Todesurteile vollstrecken ließ. Die Bundeswehr betont seine demokratischen Verdienste.

Die „Topographie des Terrors“ zeigt in einer Ausstellung über den Volksgerichtshof, wie aus einer politischen Justiz ein Terrorinstrument erwuchs.

In den Rechtswissenschaften treiben führende NS-Theoretiker bis heute ihr Unwesen. Eine Initiative fordert „Palandt umbennen“.

Der Ballast der NS-Diktatur wog noch schwer, als Romani Rose den Kampf um Anerkennung der deutschen Sinti und Roma begann.
