Wrestler „Zack Ryder“ über seinen Sport: „Ich habe mir diesen Status erarbeitet“
Der amerikanische Wrestler Matthew Cardona über seinen Traumberuf, die kostbare Zeit mit der eigenen Familie und die vergleichsweise hohe Verletzungsgefahr.
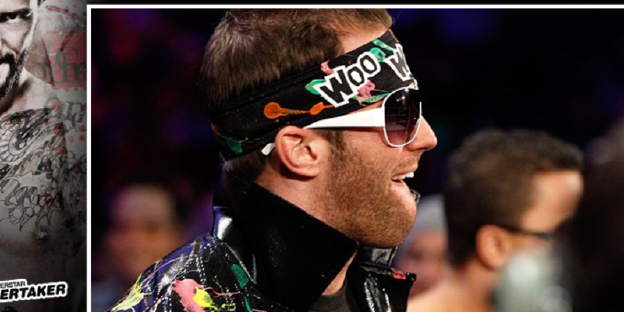
Zack Ryder vor einem Kampf. Bild: screenshot: de.wwe.com
taz: Wie viele Tage im Jahr sind Sie unterwegs?
Matthew Cardona: Das habe ich noch nie wirklich gezählt. Es gehört zu unserem Leben einfach dazu. Grob geschätzt sind das vier, fünf Tage die Woche, die Veranstaltungen nicht mit eingerechnet.
Das macht knapp 250 Tage. Wie viel Zeit bleibt da, zur Ruhe zu kommen?
Man lernt es. Jeder Moment mit der Familie und Freunden wird kostbarer. Aber auch in unserer Freizeit müssen wir ja regelmäßig in den Kraftraum, das ist ein Teil des Alltags, der fast schon entspannend ist.
Klingt auf den ersten Blick nicht nach großem Spaß.
Ich habe mir das so ausgesucht. Andere Kinder wollen Astronaut oder Polizist werden, ich wollte vom ersten Moment an in den Ring. Meine Mutter ist fast wahnsinnig geworden – schließlich bin ich direkt nach der High School gleich auf eine Wrestlingschule, mit einem Exstar als Trainer, der uns die Bewegungen beigebracht hat. Kein richtiger Schulabschluss, erst recht kein College, kein Studentenleben – das hat ihr nicht wirklich gefallen, um es nett zu formulieren. Aber was blieb ihr anderes übrig? Mittlerweile unterstützt sie mich so wie mein Vater, der von Beginn an keine Probleme mit meinem Berufswunsch hatte.
Trotz der vergleichsweise hohen Verletzungsgefahr …
Dafür trainieren wir, um für alles zumindest so gut wie möglich gewappnet zu sein. Vor ein paar Wochen wurde ich in einer unserer Shows in einem Rollstuhl von einer meterhohen Rampe gestoßen. Obwohl die Landung gut geklappt hat, habe ich mich am Rücken verletzt und nutze seitdem einen Gehstock, bis alles auskuriert ist. Das passiert.
Ihr Werdegang ist nicht alltäglich. In der durchkontrollierten und -organisierten Wrestlingwelt, in der die meisten Rollen von den Kreativabteilungen erdacht werden, haben Sie Ihre eigene Figur entwickelt.
Das kann man so sagen. Ich war bis vor einem Jahr eher selten in den WWE-Shows zu sehen, weil ich in keinen der Handlungsstränge gepasst habe. Aus lauter Frustration habe ich dann angefangen, Videos auf YouTube hochzuladen, in denen ich von meinem Leben als gebürtiger New Yorker erzähle – und bekam immer mehr Fans.
… die dann mit Plakaten und Zwischenrufen während der Shows mehr TV-Zeit für Sie forderten …
So hatten die Show-Autoren keine Wahl mehr. Die Fans geben bei uns nun mal den Ausschlag. Wer eine Reaktion hervorrufen kann – ob Jubel oder Buhrufe, der hat es geschafft. Jetzt habe ich mir diesen Status selbst erarbeitet. Momentan ist in unseren Shows immer wieder von „Twitter“ die Rede, für das aggressiv geworben wird, um möglichst viel in der Öffentlichkeit präsent zu sein. Mit ein wenig Stolz kann ich sagen: Das habe ich schon früher gemacht. Wir haben viele junge Fans in meinem Alter und darunter, die nutzen die gleichen Medien wie ich, sind online, informieren sich über das, was sie interessiert. So gab es eine Schnittstelle, die nun auch unsere Kreativabteilung erkannt hat.
Wie viel von Matthew Cardona steckt in „Zack Ryder“?
Ich habe das Glück, dass ich sagen kann: Das bin ich. Gerade das macht vielleicht auch meinen Erfolg aus. Die Fans merken: Der ist echt, der verstellt sich nicht, mit dem kann man auch privat in Kontakt treten. Das ist ein Unterschied zu den achtziger Jahren, in denen die meisten Charaktere eher wie Fantasiefiguren aufgebaut waren.
Es kann auch anders laufen …
Ich weiß schon, worauf Sie anspielen. Als ich 2006 zur WWE kam, war ich eine Hälfte der „Major-Brothers“. Ich und mein Partner waren ein Brüderteam. Wir hatten beide die gleiche Größe, Statur, lange, blonde Haare – wir sollten zu diesen absoluten „Guten“ gehören, ständig lächelnde, fröhliche, überzeichnete Sunnyboys sein. Es hat zum Glück nicht funktioniert: Das Publikum hat gemerkt, was das für ein Mist war, und hat uns überhaupt nicht angenommen – in unserem Job ein Albtraum. Solche eindimensionalen Charaktere sind heute nicht mehr aktuell. Auch da müssen wir durch, selbst wenn es schwer ist.
Sie touren durch Europa, Südamerika, Asien – reagieren die Zuschauer regional unterschiedlich auf die Charaktere?
Generell sind die Fans außerhalb Nordamerikas noch ausgelassener. Es mag abgebrüht klingen, aber ich weiß gar nicht mehr genau, in welchen Ländern ich schon gewesen bin. Vom Flughafen geht es direkt ins Hotel, dann zur Halle und wieder zurück. Meistens dann auch noch im Abstand von nur ein, zwei Tagen, wenn überhaupt. Oft wünscht man sich in dem Fall schon, mehr Zeit zu haben, um sich umschauen zu können.
Also eine Selbstverwirklichung mit Abstrichen?
Die meisten von uns haben früher mit Actionfiguren ihrer Idole gespielt oder sie im Fernsehen bewundert. Jahre später steht man dann plötzlich mit einigen von ihnen, die immer noch aktiv sind, selbst im Ring, macht große Augen und denkt sich: Das ist einfach surreal. Wir Wrestler bleiben in gewisser Weise ein Leben lang kleine Kinder.



