Nach der Klimakonferenz in Dubai: Angst ist keine Lösung
Die Klimakonferenz COP28 brachte keinen Durchbruch. In Weltuntergangsrhetorik sollte man trotzdem nicht verfallen – die hilft im Kampf nicht weiter.

Nicht alle sind gleich bedroht: Den Menschen auf den Kiribati-Inseln etwa steht das Wasser schon jetzt bis zum Hals Foto: Kadir van Lohuizen/laif
Nun sind sie wieder auseinandergegangen, nach den zwei Wochen in Dubai, ohne Durchbruch, ohne den überfälligen, klaren Ausstieg aus Kohle und Öl. Ohne die Rettung also, die das Ende immer neuer Temperaturrekorde und Extremwetterereignisse bringt?
Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Bei den Klimakonferenzen ist die Frage nach dem Scheitern eine ganz eigene. Wie soll es anders sein, wenn der UN-Generalsekretär António Guterres Sätze sagt wie: „Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle mit dem Fuß auf dem Gaspedal.“ So scheint der Rahmen stets klar gesteckt: Durchbruch oder Untergang.
Als es bei der COP24 in Madrid 2019 – wieder einmal – schlecht lief, schrieb die Zeit: „Die Welt hat sich bei ihrer Klimakonferenz an den Abgrund manövriert.“ So sehen es viele auch jetzt. Viele NGOs, Forscher:innen und auch Aktivist:innen bemühten sich, in der Abschlusserklärung aus Dubai „das richtige Signal“ oder „wichtige Weichen“ zu sehen. Aber die „Wir sind verloren“-Stimmen waren nicht zu überhören.
Weil die Zeit so drängt, ist die Vorstellung verbreitet, es sei nun, diesmal, genau jetzt, die letzte Ausfahrt vor der Apokalpyse, an der gerade vorbeigerast wird – verdrängend und versagend. Es verwundert nicht, dass dieser Blick viele Menschen in Panik versetzt, denn das von Dubai die finale Weltrettung nicht zu erwarten war, schwante schon vorher vielen.
Die Rede von Kipppunkten hat Tücken
Ein Kollege twitterte Mitte 2021, die kurz darauf zu wählende Bundesregierung sei „die letzte, die die Weichen zur Bekämpfung der Klimakrise stellen kann“. Der Satz spricht dem Handeln der Zukunft seine Bedeutung ab. Denn natürlich wird es keineswegs egal sein, was die Bundesregierung, die 2025 gewählt wird, tut. Und ebenso wenig wird egal sein, was jene ab 2029 tut, auch wenn sich bis dahin Schäden vergrößert haben werden und Leid über viele Menschen gekommen sein wird.
Die Neigung, die unmittelbare Gegenwart zum finalen Umbruchpunkt zu machen, zeigt sich in der heutigen Beliebtheit der „Kipppunkt“-Vokabel, die aus der Klimaforschung heraus in die allgemeine Sprache eingesickert ist: Den „Migrations-Kipppunkt“ beschwören jene, die den Volkstod fürchten, die Formel vom „autoritären Kipppunkt“ ist angesichts des Aufstiegs der Rechtsextremen beliebt geworden.
Legt man das Verständnis von Kipppunkt zugrunde, wie es der Klimaforschung zugeschrieben wird, dann muss nun, genau jetzt, ein absolutes und vor allem irreversibles Unheil abgewendet werden. Gelingt dies nicht, ist es nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Doch was etwa den Autoritarismus angeht, haben jüngst die Beispiele Polens und Brasiliens gezeigt, dass dieser sich auch wieder zurückdrängen lässt. Wer den Lauf der Dinge aber nur noch unter der Kipppunkt-Prämisse sieht, dem wird die Kraft für die nötigen Kämpfe fehlen.
Beim Klima ist die Sache etwas anders gelagert: Eingetretene Schäden werden nur schwer oder nicht wieder aus der Welt zu schaffen sein. Geringe Korrekturen werden in Zukunft ein Vielfaches dessen kosten, was heute an Aufwand nötig wäre. Und doch wird man den betreiben müssen.
Es hat sich schon einiges getan
Die überaus düsteren Erwartungen vieler gehen zurück auf die Jahre 2018/2019. Da kamen nicht nur Greta Thunbergs Schulstreik und in der Folge Fridays for Future auf. Es verbreiteten sich – auch über die Kanäle der Klimabewegung – Studien, die konkret vom drohenden Ende der Menschheit sprachen.
Die zugrunde gelegten Szenarien deuteten auf eine Erderwärmung von bis zu 5 Grad bis zum Jahr 2100 und damit auf einen Zustand hin, in dem das menschliche Überleben fraglich würde. Ein EU-eigener Thinktank warnte wegen der Erderhitzung vor „im schlimmsten Fall dem Aussterben der gesamten Menschheit“. Das prägt den Blick auf die Klimakrise bis heute.
Dabei ist seit 2018 im globalen Klimaschutz eben doch einiges geschehen – und zwar ganz wesentlich auch durch den Einfluss der Klimabewegung. Heute, wenige Jahre später, hält die Wissenschaft 2,7 bis 2,9 Grad Erderwärmung für am wahrscheinlichsten. Auch damit allerdings werden Teile der Erde unbewohnbar und Vertreibung und Tod für viele Menschen die Folge sein.
Und trotzdem geht es „nicht um alles oder nichts“, wie der US-Klimaforscher Zeke Hausfather sagt. Es dürfe sich nicht die Vorstellung verfestigen, „dass wir entweder gerettet oder dem Untergang geweiht sind“. Alle werden in Zukunft unter der Erderwärmung leiden, weil die Emissionen nicht sofort zu stoppen seien, egal, was geschehe. „Die Frage ist, wie viel Leid wir haben und wie viel wir retten können.“
Ignorante Gleichmacherei
Viele denken, es müsse schon deshalb vom „Aussterben der Menschheit“ die Rede sein, um den Menschen klarzumachen, wie schlimm es um die Erde steht. Nur so lasse sich der Druck aufbauen, um das nötige Handeln zu erzwingen. Doch die Folgen solcher Kommunikation sind ambivalent: Erkenntnis und politische Reaktion stehen neben Überforderung und Abwehr.
Die Rede vom Untergang der Menschheit ist dabei auch eine Gleichmacherei, die ignorant ist gegenüber dem konkreten Leid: Wer so tut, als ob es nur Sieg oder totale Niederlage gibt, reißt die enormen Unterschiede der Betroffenheit ein. Dann ist das Unheil absolut und trifft alle gleich. Doch tatsächlich wirken die Risiken sich sehr unterschiedlich aus. Die gegenwärtigen und die historischen, kolonial geprägten Mechanismen der Ressourcenverteilung bestimmen, wer wie verwundbar ist.
Wie sehr die realen ökologischen und sozialen Zusammenbrüche im Globalen Süden für viele dort schon heute das Ende ihrer Welt bedeuten, wird verwischt, wenn alle gleichermaßen als Opfer einer der Menschheitskatastrophe gesehen werden. Denn jene, die bereits jetzt ihre Lebensgrundlagen verlieren, tragen dafür in der Regel am wenigsten Verantwortung – und haben die wenigsten Ressourcen, um sich zu wappnen.
Dieses Missverhältnis zu korrigieren ist nur als mühsamer, kleinteiliger Prozess vorstellbar. Der Gedanke an schrittweises Handeln angesichts eines Kontinuums erodierender Lebensgrundlagen wird aber zu oft von einer binären Vorstellung verbleibender Möglichkeiten verdrängt: Durchbruch jetzt oder Apokalypse.
Beschwörung des Systemkollaps
Viele sehen diese auch deshalb kommen, weil sie voneinander unabhängige oder nur teilweise verbundene Krisen zu einem umfassenden zivilisatorischen Rutschen zusammendenken. „Fragile States – apokalyptische Seelenzustände und ihre Vergemeinschaftung“ hieß ein Vortrag auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Psychoanalyse 2021. „Überall auf der Welt spitzen sich soziale und wirtschaftliche Krisen zu“, hieß es da. Immer häufiger würden Stimmen laut, die das Szenario eines Systemzusammenbruchs entwerfen.
Manchen hilft es, so mit der Komplexität der Welt umzugehen: Wo überall Katastrophen zu sehen sind, bietet der Gedanke, es stecke etwas Allgemeines, Größeres dahinter, eine trügerische Erleichterung. An das Wirtschaftssystem denken dabei indes nur wenige – der Glaube an Verschwörungen ist vielen näher. Die Bereitschaft der Menschen, ihren Untergang zu erwarten, ist seit jeher hoch.
„Seit nachweislich 3.000 Jahren hatte bisher jede Generation die Vorstellung, sie werde die letzte auf Erden sein, oder zumindest ihre Kinder die Apokalypse erleben“, schreibt der Psychoanalytiker Wolf-Detlef Rost. Darin spiegle sich eine „Mischung aus Schuldgefühl und Grandiositätsfantasien, die letzte menschliche Generation zu sein, damit zum Vollstrecker der Geschichte zu werden.“
So gesehen neigt der Mensch zum Exzeptionalismus – er ist stets überzeugt, an einem Wendepunkt der Geschichte zu leben, wie der Göttinger Religionssoziologe Alexander Kenneth-Nagel meint. Früher war es die Bibel, die mit den prophetischen Ankündigungen der Apokalypse, auf die das Reich Gottes folgen würde, den Untergang predigte.
Hin zu „Jedes Zehntelgrad zählt“
Seit der Aufklärung, spätestens aber seit der Erfindung der Atombombe sind die religiösen Vorstellungen oft nur noch der unbewusste kulturelle Unterbau, auf den trifft, was die Naturwissenschaft kommen sieht. Doch anders als in früheren Zeiten ist der Mensch heute für die Krise selbst verantwortlich – „und wird nun zum Sachwalter der eigenen Erlösung oder ihres Ausbleibens“, so Kenneth-Nagel.
Der Klimabewegung insgesamt wird dabei zu Unrecht Apokalyptik vorgeworfen wird. Denn ihr Widerstand, ihre Opferbereitschaft, ihre Unbedingtheit sind nur dadurch zu erklären, dass sie glauben, etwas erreichen zu können, wenn sie nur genügend Druck aufbauen. Tatsächlich ist bei vielen an die Stelle der Parole „Die Klimakatastrophe stoppen“ längst „Jedes Zehntelgrad zählt“ getreten. Ernsthaft fatalistisch sind deshalb nicht sie. Das sind jene, die der Gestaltbarkeit der Zukunft keine Chance mehr geben – als Folge von Verdrängung, Abspaltung, Schuldgefühlen, Ignoranz, Egoismus oder Bequemlichkeit. Sie sagen: Es bringt ohnehin nichts mehr.
Aber das ist nicht wahr. Die Ressourcen sind da. Die Menschheit hat mehr, als nötig ist, um ihre Existenz auf andere materielle Grundlagen zu stellen als bisher. Die Möglichkeiten zur Vernetzung, um diesen Wandel durchzusetzen, sind für die heutige Generation größer als für jede andere zuvor.
Doch sich der Zerstörung und dem Fatalismus entgegenzustellen, erfordert Kraft und Glauben an die Gestaltbarkeit der Zukunft. Und zwar auch in kleinen Schritten.
Der Autor veröffentlichte im September das Buch „Endzeit – Die neue Angst vor dem Weltuntergang und der Kampf um unsere Zukunft“ im Ch. Links Verlag, auch erhältlich im taz Shop.



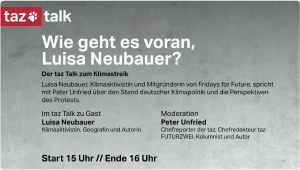

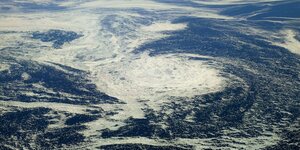


Leser*innenkommentare
Mitch Miller
"Und ebenso wenig wird egal sein, was jene ab 2029 tut,"
Das sagt implizit, dass man das jetzt nur noch durchstehen muss, aber dann hat man keine Verantwortung mehr, weil es eh egal ist, weil "die davor" nichts getan haben.
"„Seit nachweislich 3.000 Jahren hatte bisher jede Generation die Vorstellung, sie werde die letzte auf Erden sein, oder zumindest ihre Kinder die Apokalypse erleben“,"
Mit dem kleinen Unterschied, dass das meist kleine Gruppen Fanatiker waren - JETZT ist es die an 100% grenzen Mehrheit der Wissenschaft, basierend auf Fakten und glasklarer Beobachtung.
Hoagie
Schöner Kleister.
StromerBodo
Es ist mir schon länger zuwider, wie da Sein oder Nichtsein in die Klimakonferenzen projiziert werden - derweil die Fakten nicht dort, sondern in den einzelnen Staaten geschaffen werden. Paris 2015 war so ein Ultra-Hype - als dort das 1,5°-Ziel verabschiedet war, großer Jubel - und ich erwartete, dass es jetztz endlich hierzulande losgehen müsse mit den Klimaschutzbemühungen - aber nichts passierte ! Selbst die tollen Meiden hatten ihren Hype gehabt und wandten sich anderen Themen zu. Wir müssen uns endlich mehr auf das konzentrieren, was in Deutschland und Europa passiert, das ist der Ort des Handelns !
Rudi Hamm
Wo ist eigentlich der Plan B ?
Also Hochwasserschutz, verbesserte Katastrophendienste, Warnsysteme die auch funktionieren, Notbevorratung, Notunterkünfte und Katastrophenpläne, für den Fall, dass wir das Ziel trotzdem verfehlen und der Klimawandel zuschlägt?
Wir leben hier lustig in den Tag und glauben einfach daran, dass wir den Klimawandel aufhalten können. Spätestens seit dem lächerlichen Klimagipfel von Katar, abgehalten durch Ölmultis, sollte und klar sein: "Die Politik hält den Klimawandel nicht auf", erklärt ihn aber zum neuen Steuer-Einnahmetrick.
Gute Nacht auch, mit geht der Optimismus langsam verloren.