
Jonas geht es 2015 zwischenzeitlich gut genug, um Musik zu hören und die Hände zu heben Foto: privat
Diagnose Chronisches Fatigue-Syndrom:Auf der Suche nach Atlantis
Vor achteinhalb Jahren wird Abiturient Jonas nach einer Erkältung zum Pflegefall, er leidet an ME/CFS. Seine Familie kämpft für eine wirksame Therapie.
18.6.2023, 12:00 Uhr
Die erste Begegnung mit Jonas darf nur wenige Augenblicke dauern. Langsam muss man mit ihm sprechen, bloß nicht zu laut. Jonas, 26 Jahre alt, scheint die Worte wahrzunehmen. Sein linker Arm ist angewinkelt, die knochige Hand liegt ruhig auf der Brust, ein wenig oberhalb des Herzens. Wenn die Hand still ist wie ein Stein, hört er zu, haben seine Eltern gesagt.
Wer mit ihm redet, ist auf solche Übersetzungen angewiesen. Für bewusste Bewegungen fehlt Jonas meist die Kraft. Zum Sprechen ohnehin. Er hat den Kopf zur Seite gedreht, ein hautfarbener Waschlappen verdeckt seine Augen, Silikonstöpsel schützen die Ohren. Licht und Lärm verursachen Schmerzen. Auch wenn er an besseren Tagen für kurze Zeit die Augen öffnet: Sein Gegenüber zu fokussieren, gelingt ihm nicht. Das türkisblaue Meer und die bergige Küste auf dem Foto gegenüber seinem Bett – Jonas hat es wohl noch nie betrachtet.
Mehrere Ärzte haben seine Diagnose bestätigt: Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom, kurz ME/CFS. Die Multisystemerkrankung wurde bekannt als schwerste Ausprägung von Post Covid, doch es gab sie vor der Pandemie, häufig infolge von Virusinfektionen. Allein in Deutschland sind mehrere hunderttausend Menschen betroffen, mit unterschiedlich ausgeprägten Symptomen. Jonas’ Fall gehört zu den schwersten.
Seine Krankengeschichte beginnt Ende 2013, kurz nach seinem 17. Geburtstag, mit einer einfachen Erkältung. Er wird nicht wieder gesund, fühlt sich zunehmend erschöpft, kann sich kaum mehr konzentrieren. Zum Abi schleppt er sich noch. „Mit letzter Kraft“, wie seine Eltern heute sagen.
Foto erinnert an den letzten Familienurlaub, 2014
Das türkisblaue Meer auf dem Foto erinnert an den letzten Familienurlaub, im Sommer 2014, nach dem Abi. In Norditalien läuft Jonas noch schwerfällig, schafft es, langsam ein wenig zu schwimmen. Nach der Rückkehr bricht er zusammen. Er wird zum Pflegefall und bleibt es.
Bis heute sind achteinhalb Jahre vergangen: Achteinhalb Jahre, in denen seine Mit-Abiturienten studieren und Jobs annehmen, sich verlieben und trennen, durch die Welt reisen und das Leben feiern – Jonas verbringt sie in seinem Pflegebett, ernährt über eine Sonde. In den ersten Monaten habe er vor Schmerzen geschrien, während seine Eltern stündlich mal Kühlkissen, mal Wärmflaschen auf seinem Körper verteilten. Einzig dieser Vorgang versprach ein wenig Linderung.
Jonas’ Vater Christian ist ein hagerer und groß gewachsener Mann, der den Kopf einziehen muss, wenn er zur Tür hereinkommt. Auf dem Esstisch hat er den Laptop und Ordner voller Unterlagen ausgebreitet, die dokumentieren, was die Familie in all den Jahren erlebt hat: Ärztebriefe, Laborbefunde, Korrespondenz mit Kliniken und Behörden. Gut 3.000 E-Mails sind zusammengekommen. Für diesen Text hat er Einblick in die wichtigsten Dokumente gegeben. Darauf und auf den Berichten der Familie basiert dieser Artikel. Jonas heißt wirklich Jonas, aber er hat den Wunsch geäußert, darüber hinaus ein Stück Anonymität zu wahren. Deswegen haben er und seine Familie hier nur Vornamen.
Was Jonas krank gemacht hat, verraten die Unterlagen nicht. Eine frühere, unbemerkte Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus? Ein Zeckenbiss? Womöglich spielte auch genetische Veranlagung eine Rolle – Andrea, Jonas’ Mutter, ist selbst seit 20 Jahren an ME/CFS erkrankt. Arbeiten kann die Ernährungswissenschaftlerin nicht, doch zu Hause kämpft sie sich durch den Alltag.
Während das Babyfon jeden lauteren Atemzug von Jonas ins Wohnzimmer überträgt, fällt der Blick auch hier auf ein Bild aus besseren Zeiten: eine Landkarte. Sie tapeziert fast die ganze Wand, handgemalt und zusammengeklebt aus einzelnen A-4-Blättern. Eine Fantasiewelt voller Straßen, Meere und Landschaften. Jonas, einst begeisterter Wanderer mit Faible für Geografie, hat sie als 11-Jähriger entworfen. Auch Atlantis zeichnete er darauf ein. In Jonas’ Karte liegt das sagenumwobene Inselreich zwischen einem „verwinkelten Sumpf“ und „Venedig“. Von dort sind es mit der Fähre knapp 40 Minuten.
Wohnzimmer so unerreichbar wie das versunkene Atlantis
Nur ein Dutzend Schritte wären es für Jonas bis zu seiner Karte, doch für ihn ist das Wohnzimmer so unerreichbar wie für Forscher das versunkene Atlantis. Wie die Wohnung genau aussieht, in der er seit dem vergangenen Jahr wohnt, weiß er nur aus Beschreibungen seiner Familie.
„Wenn er sich ärgert, schafft er es manchmal, ein einzelnes Wort herauszuhauchen“, sagt Jonas’ Vater. Meist läuft die Kommunikation vor allem über spärliche Klopfzeichen. Ein kleines Geräusch, eine merkliche Unruhe machen den Anfang. Dann möchte Jonas sich mitteilen.
Es beginnt ein Raten: Möchtest du etwas sagen? Könnte es dies sein? Wenn Jonas’ Familie Glück hat, klopft er sich mit dem Finger auf die Brust, als Bestätigung, das Richtige erkannt zu haben. Auf diesem Wege, sagt Vater Christian, habe Jonas darum gebeten, öffentlich über ME/CFS zu sprechen.
Es ist eine Erkrankung, die Jonas’ Familie immer wieder an ihre Grenzen bringt. Im November 2014 – er liegt zum dritten Mal innerhalb eines Jahres in der Freiburger Uniklinik – schreibt Vater Christian eine E-Mail an seine Geschwister, Betreff: „Horror und Wunder“. Jonas, 1,82 Meter groß, sei auf weniger als 42 Kilogramm abgemagert, zeige „typische Anzeichen des Verhungerns“. Bitter fügt er an: „Einen schwerstkranken Sohn zu haben, ist Belastung genug, aber auch noch gegen Ärzte und eine ganze Klinik kämpfen zu müssen, treibt einen an den Rand der Verzweiflung.“
Auslöser der Auseinandersetzung zwischen Jonas’ Familie und den Ärzten ist PEM, die Post-Exertionelle Malaise. ME/CFS-Betroffene leiden an den unterschiedlichsten Symptomen, doch PEM haben sie gemein: Überschreiten sie ihre Grenzen, folgt ein Crash. Die Symptome verschlimmern sich, nicht selten dauerhaft. Weil bereits Lichtreize und Geräusche überlastend sein können, sind Kliniken mit ihren Standardzimmern und betriebsamen Gängen nicht auf ME/CFS-Patienten ausgelegt. Viele dieser Patienten sind zu krank für ein normales Krankenhaus.
Durch die Uniklinik zum Schwerstkranken

Die Familie 2007 beim Wandern in Österreich Foto: privat
So ging es auch Jonas, sagen seine Eltern. Vorher sei er schwach gewesen, doch er konnte laufen, reden. Auf die drei Aufenthalte in der Uniklinik führen sie es zurück, dass Jonas dauerhaft zum Schwerstkranken wurde. Alle Ärzte, sagt Christian, hätten das Beste gewollt – dennoch spricht er von einer „katastrophalen Fehlbehandlung“.
Weil die Klinik ME/CFS nicht erkannt, auf die Besonderheiten der Erkrankung keine Rücksicht genommen habe. Es war 1969, als die Weltgesundheitsorganisation das Syndrom als neurologische, also organische Erkrankung anerkannte. 1994 kritisierte eine deutsche Regierungskommission, dass Ärzte sie zu leichtfertig als „psychosomatisch-psychiatrische Störung“ einstuften. Die Bundesärztekammer und das Robert-Koch-Institut benennen körperliche Ursachen – etwa eine erhöhte Immunaktivität, Entzündungsprozesse, Virusreste oder Autoantikörper im Blut. Doch weil Ärzte mit ihren Standarduntersuchen davon nichts bemerken, glauben viele weiter an rein psychische Probleme.
Jonas’ Unterlagen zufolge vermuten auch die Freiburger Klinikärzte seelische Belastungen hinter den Beschwerden, eine „atypische Essstörung“, eine „somatoforme Schmerzstörung“. Weil Jonas empfindlich auf Reize reagiert, glauben sie, der Patient wolle sich „abschotten“, er verweigere Hilfe.

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.
Die Deutung hat Folgen für die Therapie. „Man zwang ihn zur Aktivierung ohne Pausen“, sagt sein Vater. Ein Einzelzimmer sei Jonas verwehrt worden, statt Schonung wurde Physiotherapie angesetzt. Als er zu schwach ist, die nur wenige Zentimeter entfernte Teetasse zum Mund zu führen, habe die Pflegeleiterin ihm nicht geholfen – weil der durstige Patient sich bewegen solle.
Und während ein Psychiater seinen Sohn befragt, trotz extremer Erschöpfung und obwohl der signalisiert, nicht mehr zu können, habe Jonas schließlich den Alarmknopf ausgelöst, um von dem Arzt befreit zu werden. Vieles hält Jonas’ Vater in Notizen fest, unabhängig prüfen lässt es sich nicht.
Ein Sprecher des Uniklinikums teilt mit, dass er sich zu einem so weit zurückliegenden Fall nicht detailliert einlassen könne. Die Kritik, die so ähnlich bereits Selbsthilfegruppen äußerten, nehme man jedoch sehr ernst. „Die Sensibilisierung zum Thema ME/CFS hat allgemein, aber auch am Universitätsklinikum Freiburg, in den letzten Jahren zugenommen“, sagt der Sprecher.
Er betont, dass aus Sicht des Krankenhauses „am häufigsten“ organische Auslöser – auch „unverstandene“ – für eine ME/CFS-Erkrankung verantwortlich sein dürften. Diese führten „zu Symptomen mit psychosomatischem Charakter“, zur Therapie aber gebe es bislang keine von den Fachgesellschaften anerkannten Leitlinien.
Die Schrecken sind nicht vorbei
Am 18. November 2014 setzt Jonas in krakeliger Handschrift seinen Namen unter eine Erklärung, mit der er die Ärzte im Uniklinikum darum bittet, „so schnell wie möglich nach Hause“ zu dürfen. Es ist bis heute das letzte Dokument, das Jonas unterschrieben hat.
Nach längerem Hin und Her lassen sich die Ärzte darauf ein, Jonas eine Magensonde zu legen. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass seine Eltern ihn zu Hause pflegen können. Es ist neben all dem Horror das „kleine Wunder“, von dem Christian seinen Geschwistern in der Mail berichtet.
Doch der Schrecken ist damit nicht vorbei. Wie die Uniklinik drängt auch eine Hausärztin zur Weiterbehandlung in einer psychosomatischen Klinik. 2015 beantragt sie beim Amtsgericht, einen Vormund für Jonas zu bestellen, der dann eine Zwangseinweisung durchsetzen könnte. Andere Ärzte überzeugen das Gericht schließlich davon, dass der junge Mann bei seinen Eltern gut aufgehoben sei.
So erfährt die Familie hautnah, welche Konflikte in der Ärzteschaft um die Erkrankung brodeln, für die bis heute eine heilende Therapie fehlt: Die einen erkennen ME/CFS und PEM als körperlich verursachte Symptome an und raten Patienten, ihre individuellen Belastungsgrenzen unbedingt einzuhalten, um nichts zu verschlimmern. Andere, vor allem Psychosomatiker, empfehlen möglichst viel Aktivität, im Glauben, damit einer „Dekonditionalisierung“ entgegenzuwirken.
Der Streit ist bis heute aktuell – und hochpolitisch. Am deutlichsten zeigt das der Aufstand, den das unabhängige, evidenzbasiert arbeitende Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) auslöste, als es im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums Wissen über ME/CFS zusammenzufassen sollte.
Aktivierungstherapie führt zu bleibenden Schäden
Im vergangenen Oktober stellte es einen Entwurf zur Kommentierung ins Internet und rückte darin ausgerechnet eine Therapie in den Fokus, die sich steigernde Aktivitäten des Patienten vorsieht. Zur Begründung verwies das Institut vor allem auf eine britische Studie, die grobe wissenschaftliche Mängel aufwies und PEM – also die Crashs nach Überlastung – gar nicht berücksichtigte.
Monatelang bekämpften sich Wissenschaftler hinter den Kulissen, auf Podien und in sozialen Medien. Betroffene starteten Postkartenaktionen an das Institut und verwiesen auf unzählige Erfahrungsberichte, in denen Patienten beschreiben, wie ausgerechnet eine solche Aktivierungstherapie zu bleibenden Schäden geführt habe.
Im April dieses Jahres legte das IQWiG seinen finalen Bericht vor. Er unterscheidet sich deutlich vom Entwurf: Der Nutzen der gestuften Aktivierungstherapie? Fraglich. Ein „relevanter Nachteil durch schwerwiegende Nebenwirkungen“ hingegen sei nicht ausgeschlossen. Damit steht fest, dass kein Arzt sich mehr auf Evidenz berufen kann, will er die gestufte Aktivierungstherapie empfehlen. Wie schnell sich das herumspricht, ist allerdings eine andere Frage.

Zwar nicht Atlantis – trotzdem schön: Jonas (r.) und sein Bruder Julian 2012 auf La Palma Foto: privat
Die zweite Begegnung mit Jonas folgt nach einer Stunde Pause, in Begleitung von Julian, Jonas’ jüngerem Bruder. Trotz der vier Jahre Altersunterschied seien sie stets „wie Zwillinge“ gewesen, sagt der 22-Jährige. Nun sitzt er täglich am Pflegebett, um Jonas von der Welt zu berichten.
Mit einem dezenten Räuspern macht er sich bemerkbar, legt kurz seinen Arm auf die Schulter des Älteren, kniet sich auf einen Drehstuhl und lehnt sich ans Geländer des Pflegebettes. „Ich wollte dir ja noch vom ESC erzählen“, sagt Julian leise. Jonas’ Finger zucken leicht nach oben. Kurz warten, heißt das, er muss das erst verarbeiten.
Zuerst die Kopfschmerzen, dann bleierne Schwäche
So detailverliebt, wie Jonas seine Landkarte gezeichnet hatte, malt Julian mit Worten ein buntes Bild vom Eurovision Song Contest, der wenige Tage zuvor ausgetragen wurde. Er beschreibt die auffliegenden Lichtstrahlen der Scheinwerfer, die schrillen „You wanna see me dance?“-Rufe der israelischen Sängerin oder das quietschgrüne Bizepskostüm des finnischen Rappers. „Cha, Cha-Cha, Cha-Cha-Cha-Cha“, singt Julian. Seine schulterlangen, blonden Haare fliegen über die Bettdecke des Pflegebetts. „Das hab ich jetzt nur geflüstert gemacht, aber stell’s dir in laut und rockig vor.“ Jonas verfolgt alles mit leicht geöffnetem Mund.
Für eine kurze Zeit im Jahr 2015 konnte er selbst wieder Musik hören. Die Antibiotika-Therapie einer Borreliose-Expertin hatte die Schmerzen vertrieben. „Wie wachgeküsst“ sei der Junge, schreibt Vater Christian in einer E-Mail an seine Familie: Jonas führte Gespräche, lachte. Nach einigen Monaten aber kehrten erst die Kopfschmerzen zurück und dann diese bleierne Schwäche.
Seitdem ist an Musik und Gespräche nicht mehr zu denken. Für Andrea, Christian und Julian bedeutet das: 16 Stunden Pflegebedarf am Tag. Ganze zwei Stunden nimmt das Vorbereiten der Sondennahrung ein, das Kochen und Pürieren, das Abwiegen der Nährstoffe, exakt nach ärztlichem Rat und berechnet mithilfe einer Excel-Tabelle, weil Jonas fertige Nahrung nicht verträgt.
Um alles zu schaffen, musste Christian seinen Job aufgeben. Dass der Kaufmann heute wieder im öffentlichen Dienst arbeiten kann, ist nur möglich, weil die Familie eine Pflegehilfe angestellt und in der eigenen Wohnung untergebracht hat. Auf durchschnittlich 40.000 Euro im Jahr summierten sich die Ausgaben für ihr Gehalt, für Laboruntersuchungen und private Arztrechnungen, für Nährstoffe und Medikamente. Seit dem vergangenen Jahr bezahlt das Sozialamt die Pflegekraft.
Das gibt der Familie zwar ein bisschen Sicherheit, schützt sie aber nicht vor Unvorhergesehenem. Jonas übersteht eine Corona-Infektion, eine schwere Lungenentzündung – und einen Gasalarm: Als Nachbarn vor einigen Jahren Probleme mit ihrer Heizung haben, ordneten Behörden kurzfristig die Räumung der Wohnung an.
Der Vater harrte mit Jonas zuhause aus
Doch weil es unmöglich war, mit Jonas aus dem zweiten Stock herauszukommen, harrte der Vater mit ihm zu Hause aus. Es war einer der Anstöße für den Umzug aus der Stadt ins Umland im vergangenen Jahr, den Jonas nur sediert bewältigen konnte. Nun wohnt die Familie ebenerdig und besitzt für den Fall der Fälle eine Rettungstrage.
Irgendwie durchhalten, das ist der Plan. In der Hoffnung, dass die Ampel ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag vielleicht doch noch erfüllt
Wie viel er heute von den Besuchen wahrnimmt? Sehr viel, ist Julian sicher. Als er dem Bruder im Winter 2022 den aktuellen Spielplan der Fußball-WM vorrechnete, sei Jonas einmal ganz unruhig geworden – offenbar hatte er sich Julians Berichte der Vortage genau eingeprägt und bemerkt, dass er nun eine Mannschaft irrtümlich in die falsche Gruppe einsortiert hatte.
Und tatsächlich gibt es seit einem Jahr leichte Verbesserungen. Ohne sie wäre ein Besuch undenkbar gewesen. Mal öffnet Jonas die Augen, mal kann er Arme und Beine ganz leicht bewegen. Nur was, wenn Jonas’ Vater, den die Bandscheiben plagen, einmal ausfällt?
Irgendwie durchhalten, das ist der Plan. In der Hoffnung, dass die Ampel ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag – bessere Versorgungsstrukturen für ME/CFS-Erkrankte – vielleicht doch noch erfüllt. Und vor allem darauf, dass die Forschung, die durch Post Covid immerhin ein wenig Geld erhalten hat, endlich ein Medikament hervorbringt.
Vielleicht ist es wie die Suche nach Atlantis, dem versunkenen Inselreich. Würde man es finden, irgendwo da draußen, Jonas’ Familie wäre bereit für eine Reise durch noch so verwinkelte Sümpfe, auch ohne Fähre von Venedig.
„Wir würden alles probieren“, sagt seine Mutter.

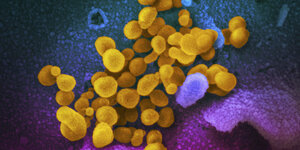


Leser*innenkommentare
Holger_0311
Ich drücke Jonas ganz fest die Daumen, dass die Medizin eine wirksame Therapie findet, die seinen Zustand und den der anderen Betroffenen verbessert.
Hochachtung habe ich auch vor den Eltern, die mit einer Mühe und Hingabe ihren Sohn pflegen, für ihn kämpfen, und dann noch politisch aktiv sind.
Denn das ist wichtig. Meine Lebensgefährtin ist seit rund zwei Jahren an ME/CFS erkrankt. Nur der Tipp von Freunden in Selbsthilfegruppen machten sie auf die PEM-Problematik aufmerksam. So konnte sie destruktive Therapien ihrer Ärztinnen abwehren und schlimmeres verhindern.
Über die Selbsthilfegruppen haben wir von einer Parallelgesellschaft erfahren, deren Existenz wir vorher nicht für möglich hielten: Erwachsene Menschen ziehen zu ihren Eltern zurück, um sich von denen pflegen zu lassen. Renter fangen wieder an zu arbeiten, um die Pflege von Angehörigen bezahlen zu können. Jugendliche liegen in abgedunkelten Zimmern rum, und keiner bekommt es mit. Für unsere moderne Gesellschaft sind solche Zustände untragbar!
Es gibt leider einen großen blinden Fleck in der Medizin als auch in der Pflege und in der Reha. Dieser muss schnellstmöglich aufgelöst werden. Menschen dürfen nicht mehr durch das Gesundheitssystem systematisch Schaden erleiden, die Forschung muss wirksame Therapien entwickeln, und die Verwaltung muss Behandlung und Pflege sichern. Es gibt viel zu tun.
Daher danke an Jonas und seine Familie, danke an die TAZ, dass über solche Schicksale, die leider kein Einzelfall sind, berichtet werden kann.
Anette73
Lieber Jonas,dein Schicksal hat mich sehr berührt. Ich habe Respekt vor deiner Stärke. Ich hoffe dass Politik und Forschung nun weiter kommen so dass für dich eine wirkungsvolle Therapie bald dir Linderung bringt. Ich habe rausgelesen,dass ein Rheumatologe mit der Krankheit beauftragt war. In der Rheumatherapie gibt es auch moderne Mittel wie MTX vielleicht ist da etwas zu finden. Alles Gute
Herma Huhn
Es ist fatal, dass es so häufig Berichte über Fehlbehandlungen dieser Krankheit gibt. Denn wenn die Betroffenen Angst vor Ärzten bekommen, ist die Hoffnung verloren, je den individuellen Auslöser zu finden und ihn zu behandeln.
Die Borreliosebehandlung zum Beispiel, kann bei vielen Besserung schaffen. Leider nicht bei allen. Bei anderen wird irgendwann ein Mangel entdeckt, der nicht auf der Ernährung, sondern der Verdauung beruht. Auch das würde ohne Ärzte nicht entdeckt werden.
Ich wünsche allen Betroffenen das Glück einen Arzt zu finden, der nicht nur das Wissen, sondern auch die Geduld hat, die Lösungssuche innerhalb der Fähigkeiten des Patienten weiterzuführen, bis eine Lösung gefunden ist.
R.A.
Berührender Bericht. Alle guten Wünsche für die Familie!
Das Inachtnehmen vor der Behandlung der Ärzte kenne ich aus meinem fam. Umfeld.
Aktivierung und immer wieder der Hinweis zu einem Sportstudio. Hat alles verstärkt.
Erst die Behandlung bei einer Heilpraktikerin, mit Chiropraktik, brachte Erleichterung, ebenso Lockerung und sanfte Massage.
Es geht langsam aufwärts
Mitch Miller
"drängt auch eine Hausärztin zur Weiterbehandlung in einer psychosomatischen Klinik. 2015 beantragt sie beim Amtsgericht, einen Vormund für Jonas zu bestellen"
Da packt mich die Wut. Solchen Leuten wünsch ich mal ein paar Wochen ME/CFS.
Ich hatte im Zusammenhang mit Corona einige Schübe, die ich mittlerweile dahin einordnen würde.
Ich hatte aber noch genügen Kampfgeist, meinen Hausarzt, der da gottseidank sensibler war, um "irgendwas" zu bitten, das die unglaublich erschöpfende, m.E. "Entzündung" in meinem Kopf bekämpft (so fühlte es sich an...nicht exakt wie Kopfschmerzen).
EINE Tablette, EINE Sunde später war ich wie neugeboren in einem Schub CFS, der mich nahezu arbeitsunfähig gemacht hat. Anhaltend.
Und das wiederholt, bei schwächeren, aber immer noch sehr störenden Schüben.
Für mich klingt die Symptombeschreibung bei Jonas sehr ähnlich, nur extrem stärker: völlig Hirnüberlastung, weil im Dauerfeuermodus und dadurch total erschöpft. Selbst schlafen geht nicht, weil Dauerfeuer.
Ich will hier keine öffentliche Medikamentenempfehlung geben, aber bin gerne bereit, die Info weiterzugeben über die Redaktion.
04405 (Profil gelöscht)
Gast
Die "heilende Therapie" bei CFS fehlt vor allem aus Unwissenheit. Die klinische Forschung und der Fortschritt in Wissen und Behandlung schreitet fort, und trotzdem gibt es genug Indikationen, für die schlicht das Wissen nicht ausreicht. Auf dem Weg zur heilenden Therapie passiert so mancher Fehler, laufen Forscher in Sackgassen oder lassen versehentlich den korrekten Ansatz fallen. Sollten die Ärzte dann einfach sagen, "Tut mir leid, ich kann nix für Sie tun, gehen Sie doch einfach nach Hause, viel Glück noch"?
Daher eignen sich manche Themen nicht für solch radikal emotionalisierte Berichte, in denen von einem "Kampf gegen Ärzte" die Rede ist. An manchen Stellen scheint gar durch, Therapeuten könnten aus bösem Willen oder mangelndem Verantwortungsbewusstsein Ansätze verfolgt und verkauft haben, von denen sie selbst Wissen, dass es nicht zum Erfolg führen will. Es ist geradezu charakteristisch für Indikationen, bei denen ein Goldstandard der Behandlung nicht existiert, dass es höchst widersprüchliche Studien und Evidenzen gibt, wiederum aus: Unwissenheit. Bevor man eine gut gemachte Studie zu einer Behandlungsform entwerfen kann, muss man die unterliegenden Probleme und Mechanismen überhaupt erst verstanden haben. Bei allem Mitgefühl für die Situation der Patienten dürften solche Anklagen ohne rechte Grundlage niemals geschrieben werden.
Likiam
@04405 (Profil gelöscht) Der Diagnoseschlüssel zu ME/CFS besteht seit den 60ern und definiert es als neurologische Erkrankung mit Belastungsintoleranz. Eine Überlastung des Systems führt zu Verschlechterung. Die wichtigste Therapie ist Pacing, also innerhalb der Grenzen bleiben. Dem zum Trotz wird diese Erkrankung immer wieder als psychosomatisch eingestuft (weil keine der ü lichen Biomarker zu finden sind) und Betroffene in Aktivierungsmaßnahmen geschickt, mit nachhaltiger Verschlechterung des Zustandes. Nach wie vor! Obwohl es eindeutige Diagnosekriterien, physische Test (infos verfügbar auf der Seite der Charité ) und Leitfäden zur Versorgung gibt.
Keine andere Erkrankung steht nach so vielen Jahren mit noch so wenig Studien, Versorgungszentren (eine!! Nur für Berliner und Brandenburger) und so wenig Anerkennung im behördlichen Kontexten da.
Es ist allerhöchste Zeit für solche Artikel. Denn selbst wenn es noch keine Medikamente/Therapien gibt, so muss ganz ganz dringend endlich diese massive Fehlbehandlung aufhören. So schafft sich das System immer mehr Pflegefälle.
Sebastian Schneider
@04405 (Profil gelöscht) Die Grundlegende Schwierigkeit, sehe ich nicht unbedingt in der Tatsache das hier ggf. "herumprobiert" wurde sondern das die Erfahrungsberichte der Eltern so komplett ignoriert wurden sowie der Wunsch des Patienten aufzuhören wenn es zu viel wird, so dass er sich nur noch mit dem Notfall Knopf zu helfen wusste. Das Zeugt eher von Ignoranz der Ärzteschaft und das darf man schon anprangern.
Martin M
@04405 (Profil gelöscht) Die Ärzte sollten nicht beim ersten Zweifel sagen "tut mir Leid, ich kann nichts für Sie tun". Aus eigener Erfahrung helfen aber die Ärzte am meisten, die gleich zu Anfang sagen, was sie alles nicht wissen. Sonst ist man doch recht schnell im Bereich des Experimentierens ohne dass der Patient es überhaupt weiß. Wenn Unsicherheiten klar kommuniziert wurden, war das Ergebnis wirklich "Pech". Wenn nicht, dann war es Verantwortung der Klinikleitung.
04405 (Profil gelöscht)
Gast
@Martin M sie machen es sich deutlich zu einfach. Bei Ihrer Einschätzung, die Ärzte sollten gleich ihre Zweifel mitteilen, würden genug Behandler energisch widersprechen. Die entgegengesetzte Auffassung, man sollte möglichst viel Sicherheit ausstrahlen, um Vertrauen und Placebo-Effekte zu bewirken, lässt sich genauso gut begründen.
Die meisten Diagnosen und auch die meisten Messmethoden sind mit ziemlichen Unsicherheiten behaftet. Da Seltenes selten ist, treffen diese Diagnosen dann doch meistens zu.
Diese fachlich ganz gut begründbare Vorgehensweise mit "Experimentieren" zu übersetzen, ist dann sehr schwarz-weiß gedacht. Und wer trägt überhaupt die Verantwortung für einen schweren Verlauf? Das Problem, dass man zwar überhaupt nix genaues weiß, sich aber trotzdem in der Einschätzung sehr sicher ist, lässt sich ebenso auf der anderen Seite verorten.
Adelheid Schacherl
@04405 (Profil gelöscht) "Manche Themen eignen sich nicht für solch radikal emotionalisierte Berichte?"
Es ist ein Tatsachenbericht.
Ich denke schwerverdaulich, wegen/trotz "all des Mitgefühls" (Wo?)
Wie schafft man es überhaupt Interesse für die Dahinsiechenden armen Menschen zu wecken. Der erste Schritt zu irgendeiner Form von Hilfe. Haben Sie einen Vorschlag?
Krösa Maja
Vielen Dank für den Bericht, dass auch wenn die meisten Post-Covid-Patienten sich wieder berappeln, die harten Fälle nicht wieder in Vergessenheit geraten weil sie zu fertig sind, für sich zu sprechen.
Ich hatte Glück; mein "endgültiger" Crash nach ca. 10 Jahren Durchschleppen war Ende 2021, wo das Syndrom schon Aufmerksamkeit hatte. Meine Hausärztin hat die Krankheit endlich erkannt, sich mit aktuellem Material eingelesen und mit einer Ausnahme vor den Krankenhäusern bewahren können. Bei der obligatorischen Reha hatte ich auch nochmal Glück, der Oberarzt der Rheumaklinik kannte ME/CFS sehr gut und hat mich sofort wieder nach Hause geschickt, so dass ich mich "nur" von der Fahrt erholen musste. Nur deshalb kann ich noch Kommentare unter Zeitungsartikel schreiben, im Haus rumschlurfen und mir selbst einen Tee kochen, wenn auch nicht unbegrenzt. Das erste, was man als ME/CFS-Patientin lernt, ist sich vor den Ärzten und dem Gesundheitssystem in Acht zu nehmen und immer auf der Hut zu sein in welcher Schublade man abgelegt wird, obwohl die einem ja eigentlich helfen sollten und das in den meisten Fällen auch wollen; das ist so traurig.
Odradek
Da Leitlinien fehlen, gibt es für die Erkrankung offenbar keine evidenzbasierte Therapie. In ihrer Verzweiflung versuchen Angehörige in solchen Situationen oft, eigene Konzepte zu entwickeln und vermeintliche Behandlungsfehler oder 'Schuldige' zu identifizieren. Das kennt jeder klinisch tätige Arzt. Die Zwischenüberschrift 'Durch die Uniklinik zum Schwerstkranken' suggeriert, dass es sich bei diesem Narrativ um eine Tatsache handelt. Was nicht der Fall ist.
Ich wünsche dem Jungen und der Familie alles Gute und der Wissenschaft neue Erkenntnisse bei diesem offenbar komplexen Krankheitsbild.
Holger_0311
@Odradek Als Angehöriger einer an ME/CFS erkrankten Person weiß ich leider mittlerweile zu genau, dass bei PEM eine Überlastung zu mehrtägiger Bettlägrigkeit führen kann Passiert z.B. auch schon, wenn ein Spaziergang von 500 m auf 1 km ausgedehnt wird.
Das Wissen haben leider viele Mediziner nicht. Sie finden daher in jeder ME/CFS Selbsthilfegruppe Menschen, die von einem Krankhenhausaufenthalt oder einer Reha mit bleibenden Schäden nach zurück nach Hause gekommen sind. Auch aus Unikliniken. Leider.
Siggi-20
Ein bewegender Bericht.
Lieber Jonas mit Familie, ich wünsche dir einfach nur ein Wunder und hoffe dass du irgendwann wieder schmerzfrei leben wirst.
BluesBrothers
Woher die Familie nur die Kraft nimmt. Auch wenn schal, da wirkungslos, der Bericht hat mich sehr berührt, ich wünsche Jonas von Herzen eine nachhaltige Verbesserung seiner Gesundheit.