Pränataldiagnostik in der Diakonie: Diskussion um Spätabbrüche
Die Zahl der späten Schwangerschaftsabbrüche bei den Diakonischen Diensten Hannover ist gestiegen. Laut ansässiger Geburtsklinik werde kontrovers diskutiert - wie bei allen ethisch heiklen Gesundheitsfragen.
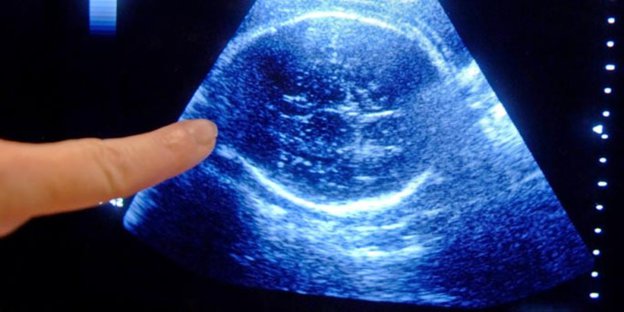
Ethisch korrekt? Die Diakonischen Dienste Hannover führen vermehrt Schwangerschaftsabbrüche nach pränataler Diagnostik durch. Bild: dpa
BREMEN taz | Darf ein evangelisch geprägtes Krankenhaus Schwangerschaftsabbrüche nach der 12. Woche durchführen? Diese Frage beschäftigt derzeit Angestellte der Diakonischen Dienste Hannover (DDH). Der Anlass ist, dass die Fallzahlen gestiegen sind, seitdem ein renommierter Pränataldiagnostiker die Klinik für Geburtshilfe leitet. Wurden im Jahr 2009 nur 14 Schwangerschaften zwischen der 10. und 22. Woche wegen einer vor der Geburt diagnostizierten Behinderung abgebrochen, waren es im Jahr darauf schon 35. Nach der 22. Woche wurden sieben Schwangerschaften abgebrochen.
"Das Thema wird bei uns kontrovers diskutiert", sagte der taz Achim Balkhoff, Leiter der Unternehmenskommunikation der gemeinnützigen Gesellschaft DDH, am gestrigen Dienstag. Unter dem Dach der DDH sind drei Kliniken und weitere diakonische Dienste zusammengefasst, darunter auch einer, der Behinderte bei der Berufsausbildung unterstützt. Dessen Leiter war in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung mit den Worten zitiert worden, solche Eingriffe seien eine "schwer erträgliche Hypothek" für die Diakonischen Dienste. Seitdem äußert er sich nicht mehr öffentlich und verweist auf den Sprecher Balkhoff.
Der wiederum zitiert aus einem Beschluss des Aufsichtsrates der DDH vom 19. September, der auch den MitarbeiterInnen zur Verfügung gestellt wurde. Darin heißt es: "Schwangerschaftsabbrüche nach Pränataldiagnostik sollen in unserem Haus seltene Ausnahme aus jeweils besonders schwerwiegendem Grunde bleiben." Weiter heißt es: "Sicherzustellen ist, dass weder denen, die diese Eingriffe vornehmen, noch denen, die diese Eingriffe und eine berufliche Mitwirkung daran ablehnen, Vorwürfe gemacht werden oder Nachteile entstehen."
Der Betriebsrat der DDH bestätigte, dass niemand gezwungen sei, sich an den Eingriffen zu beteiligen. "Wir sind eine so große Klinik, das lässt sich sogar kurzfristig organisieren", sagte der Betriebsratsvorsitzende Georg Cravillon. Dass sich jemand weigere, einen Abbruch durchzuführen oder dabei zu assistieren, komme allerdings selten vor. "Und wenn doch, dann ohne Drama." Laut Cravillon gehörten komplexe ethische Fragen, auf die es keine eindeutige Antwort gebe, in einer Klinik zum Alltag. Beispielsweise wenn es um Organentnahmen und lebensverlängernde Maßnahmen gehe.
Nach Darstellung des Unternehmenssprechers Balkhoff befinden sich die DDH in einem Diskussionsprozess. "Das ist kein hausgemachtes Dilemma", sagte er, sondern eines, dem sich die Gesellschaft als Ganzes stellen müsse. In einem von ihm verfassten Schreiben heißt es: "Die Konflikte um einen möglichen Spätabbruch einer Schwangerschaft zählen zu den schwersten, die uns in der diakonischen Praxis begegnen, da es immer auch um das Leben eines Kindes geht, das nicht für sich selbst sprechen kann." Und: "Gleichzeitig steht uns die Not, die Unsicherheit, die Angst und die Überforderung der Paare mit ihren gesundheitlichen Risiken deutlich vor Augen und wir wissen, dass wir das Leben eines Kindes nur mit, nicht gegen den Willen der Eltern / der Mutter bewahren können."
Nach der 12. Woche werden zumeist gewollte Schwangerschaften abgebrochen, weil bei einer pränatalen Untersuchung eine Behinderung entdeckt wurde.
Nach Schätzungen werden bei einer Diagnose von Trisomie 21 ("Down-Syndrom") über 90 Prozent der Schwangerschaften beendet.
2.117 Abbrüche zwischen der 12. und 22. Schwangerschaftswoche zählte das Bundesamt für Statistik im Jahr 2010. Erst danach ist die Rede von "Spätabbrüchen", 462 gab es von diesen laut Statistik im vergangenen Jahr.
Vor allem über diese Fälle wurde vor zwei Jahren heftig gestritten, weil die Feten nach der 23. Woche als lebensfähig gelten.
Der Bundestag verschärfte damals das Gesetz, seitdem müssen ÄrztInnen, die eine vorgeburtliche Diagnose stellen, eine umfassende Beratung über die Behinderung anbieten und es müssen drei Tage zwischen Diagnose und Abbruch vergehen.
Im Übrigen würde ein Viertel derjenigen abgewiesen, die mit dem Anliegen eines Spätabbruchs in die Klinik kämen, weil die ÄrztInnen die Indikation dafür nicht erkennen könnten.
Die Klinik - mit 3.500 Geburten die zweitgrößte in Deutschland - arbeitet im "Netzwerk Pränataldiagnostik Hannover" unter anderem zusammen mit Schwangerenberatungsstellen. Martina Weiß, Ärztin und Psychotherapeutin beim Beratungs- und Therapiezentrum, sagte, die Entscheidung für oder gegen einen Abbruch wegen einer Behinderung sei eine "massive Krise" für die Betroffenen. Vor allem die Mütter würden sich schwere Selbstvorwürfe machen. "Diese Leute sind verzweifelt und hoch belastet." Es wäre aus ihrer Sicht keine Lösung, sich aus deren Betreuung zurückzuziehen.



Leser*innenkommentare
Martina Lippmann
Gast
Die sollen nicht betreuen, die sollen behandeln.
Außerdem, was ist denn die diakonische Praxis, ich dachte es geht um eine medizinische. Naja, Soldaten raus aus Afghanistan, Fotos mit dem Papst, keine Erkundung von Gorleben, es handelt sich seit der Erlösung aus Gnade um eine universale Kompetenz.
Miroxa
Gast
Das Problem besteht in der unsäglichen Schwangerenliteratur und der Standardpraxis vieler Ärzte.
Dort steht z.B., "jede" Mutter möchte wissen ob ihr Kinder gesund ist. Dann werden die pränataldiagnostischen Verfahren völlig unkritisch aufgeführt. Dabei wird erstens unterschlagen, dass es um die mögliche Abtreibung eines Kindes geht und zweitens, dass die Verfahren nur Wahrscheinlichkeiten angeben können. Alles kommt als emotionalisiertes, pseudowissenschaftliches Gesülze daher.
Auch die meisten Ärzte stellen die Untersuchung gar nicht groß zur Disposition. Frauen und Paare schlittern also schnell in die Pränataldiagnostik, ohne sich im Klaren zu sein, was sie mit dem Wissen dann eigentlich machen wollen.
Nur wer sich zufällig schon vorher mit der Thematik auskennt, bzw. weiss, das Kind annehmen zu wollen, ob mit oder ohne Behinderung, kann sich da abgrenzen. Ich musste mich jedenfalls explizit dagegen wehren!!
Wir brauchen vernünftige Literatur für Schwangere und eine ärztliche Standardpraxis, die erklärt was Pränataldiagnostik bedeutet und erfragt, ob dies überhaupt gewünscht ist.
Luftikus
Gast
"Darf ein evangelisch geprägtes Krankenhaus Schwangerschaftsabbrüche nach der 12. Woche durchführen?"
Die spannende Frage ist doch: Warum zum Geier sollte ein aus öffentlichen Mitteln (Krankenkassen, Bundesländer und nein, keine Kirchensteuer) finanziertes Krankenhaus von den Patienten gewünschte und benötigte Behandlungen welcher Art auch immer mal eben so verweigern dürfen?
Martina Lippmann
Gast
Die sollen nicht betreuen, die sollen behandeln.
Außerdem, was ist denn die diakonische Praxis, ich dachte es geht um eine medizinische. Naja, Soldaten raus aus Afghanistan, Fotos mit dem Papst, keine Erkundung von Gorleben, es handelt sich seit der Erlösung aus Gnade um eine universale Kompetenz.
Miroxa
Gast
Das Problem besteht in der unsäglichen Schwangerenliteratur und der Standardpraxis vieler Ärzte.
Dort steht z.B., "jede" Mutter möchte wissen ob ihr Kinder gesund ist. Dann werden die pränataldiagnostischen Verfahren völlig unkritisch aufgeführt. Dabei wird erstens unterschlagen, dass es um die mögliche Abtreibung eines Kindes geht und zweitens, dass die Verfahren nur Wahrscheinlichkeiten angeben können. Alles kommt als emotionalisiertes, pseudowissenschaftliches Gesülze daher.
Auch die meisten Ärzte stellen die Untersuchung gar nicht groß zur Disposition. Frauen und Paare schlittern also schnell in die Pränataldiagnostik, ohne sich im Klaren zu sein, was sie mit dem Wissen dann eigentlich machen wollen.
Nur wer sich zufällig schon vorher mit der Thematik auskennt, bzw. weiss, das Kind annehmen zu wollen, ob mit oder ohne Behinderung, kann sich da abgrenzen. Ich musste mich jedenfalls explizit dagegen wehren!!
Wir brauchen vernünftige Literatur für Schwangere und eine ärztliche Standardpraxis, die erklärt was Pränataldiagnostik bedeutet und erfragt, ob dies überhaupt gewünscht ist.
Luftikus
Gast
"Darf ein evangelisch geprägtes Krankenhaus Schwangerschaftsabbrüche nach der 12. Woche durchführen?"
Die spannende Frage ist doch: Warum zum Geier sollte ein aus öffentlichen Mitteln (Krankenkassen, Bundesländer und nein, keine Kirchensteuer) finanziertes Krankenhaus von den Patienten gewünschte und benötigte Behandlungen welcher Art auch immer mal eben so verweigern dürfen?