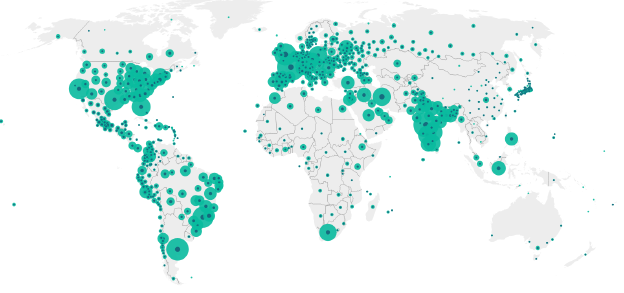Fußball-Kontinentalturnier in Kamerun: Cup der großen Sorgen
In Kamerun startet der Afrika-Cup. Schon vor Beginn des Turniers gibt es Probleme – der Bürgerkrieg im Gastgeberland ist nur eines davon.

Einer der großen Stars des Turniers: Mohamed Salah ist Ägyptens Hoffnungsträger in Kamerun Foto: Yassine Mahjoub/imago
Mo Salah und Sadio Mané mussten sich ein bisschen beeilen am vergangenen Wochenende. Nachdem die beiden afrikanischen Nationalspieler des FC Liverpool den „Reds“ mit ihren Toren beim FC Chelsea ein 2:2-Remis gesichert hatten, winkten sie noch rasch in die Menge der Liverpool-Fans. Man wird sich ja jetzt eine Weile nicht sehen. Dann machten sie sich auf zum Flughafen. Sie flogen nach Kamerun, wo vom 9. Januar bis 6. Februar die 33. Auflage des Afrika-Cups ausgetragen wird. Den Auftakt macht am Sonntag Gastgeber Kamerun mit seinem Gruppenspiel gegen Burkina Faso.
Es hat viel Aufregung gegeben um den „African Cup of Nations“, wie er auf dem Kontinent liebevoll genannt wird. Vor allem die englischen Profiklubs hatten sich in den vergangenen Wochen mal wieder mächtig aufgeregt: Das vierwöchige Turnier findet mitten in der Saison der Premier League statt, die Klubs müssen wochenlang und in vielen wichtigen Spielen auf einige ihrer größten Stars verzichten.
„Eine „Katastrophe“ nannte das Trainer Jürgen Klopp, der beim FC Liverpool neben dem Senegalesen Mané und Ägyptens Salah auch noch Naby Keïta (Guinea) ziehen lassen muss. Als Klopp im November von einem „kleinen Turnier“ sprach, das da im Januar noch auf seine Spieler zukomme, hatte er das eigentlich ironisch gemeint. Ausgelegt wurde ihm der Satz aber als Beleidigung der Menschen des afrikanischen Kontinents, die ihr größtes sportliches Ereignis in Europa nicht genügend gewürdigt sehen.
Englands dunkelhäutiger ehemaliger Stürmer Ian Wright sprach von einer „rassistisch geprägten Berichterstattung“, Ajax-Amsterdam-Stürmer Sébastien Haller kritisierte in einem Interview mit der niederländischen Zeitung De Telegraaf den Umgang der Medien mit Spielern. Die Frage, ob man nicht lieber in den Niederlanden bleibe, um dort zu spielen, zeige „den Mangel an Respekt für Afrika“, sagte der ivorische Nationalspieler. „Würde diese Frage jemals einem europäischen Spieler vor den Europameisterschaften gestellt werden?“
Brutale Waffengewalt in Kamerun
Die Diskussionen um Abstellungen sind schon fast so alt wie das Turnier selbst. 1994, als der Cup in Tunesien ausgetragen wurde, stritten Eintracht Frankfurt und der ghanaische Fußballverband wochenlang um die Abstellung des seinerzeit überragenden Torjägers Anthony Yeboah. Mit dem Resultat, dass der stämmige Angreifer damals zwischen Bundesliga- und Afrika-Cup-Spielen per Privatflieger hin- und herpendelte. Allerdings nicht lange: Nach zwei Wochen zog Yeboah sich infolge der Überlastung eine Muskelverletzung zu und konnte fortan für keines der beiden Teams mehr spielen.
Die Debatte verdrängt dabei eine Frage, die im Grunde viel wichtiger erscheint: Warum kann der Afrika-Cup aktuell überhaupt in einem Land wie Kamerun stattfinden? Das Land, das seit 1982 von dem mittlerweile 89-jährigen Paul Biya autokratisch geführt wird, befindet sich inmitten eines blutigen Bürgerkriegs. Eine englischsprachige Minderheit der Bevölkerung aus dem westlichen Teil des Landes kämpft seit Jahren um Unabhängigkeit – die separatistische Bewegung wird von der frankophilen Regierung mit brutaler Waffengewalt bekämpft. Der Konflikt, in dem die bewaffneten Gruppen seit 2017 vehement versuchen, einen abtrünnigen Staat namens Ambazonia zu bilden, hat schon mindestens 3.000 Menschen getötet und fast eine Million zur Flucht gezwungen.
In Limbe, das inmitten des aufständischen Westens liegt und das als Spielort des Afrika-Cups vorgesehen ist, wurden Sicherheitsmaßnahmen organisiert. Die Polizei hat an den Kreuzungen der Stadt bewaffnete Beamte postiert, an den Straßen, die in die Stadt führen, wurden Kontrollpunkte eingerichtet. Die Separatisten haben in den vergangenen Wochen immer mal wieder Sprengstoffanschläge verübt. In der benachbarten Regionalhauptstadt Buea gab es im November zwei Detonationen, eine davon in der Universität, bei der elf Studenten verletzt wurden.
Die Verantwortlichen bemühen sich derweil, die Gefahren herunterzuspielen. „Der Cup wird unter sehr guten Bedingungen stattfinden. Es gibt keinen Grund zur Besorgnis“, sagte Emmanuel Ledoux Engamba, hochrangiger Beamter der Buea-Regionalregierung gegenüber der überregionalen südafrikanischen Tageszeitung The Star.
Derweil sind die bewaffneten Separatisten nicht das einzige Problem des Ausrichterlandes. Im Dezember stand der afrikanische Fußballverband Caf kurz davor, Kamerun das Turnier – wie schon 2019 passiert – erneut zu entziehen. Wieder waren die Vorbereitungen des örtlichen Organisationskomitees als eher stümperhaft entlarvt worden. Weder standen genügend Unterkünfte für die zu erwartenden Teilnehmer und Fans bereit, noch war der Transport zwischen Hotels, Stadien und Trainingsstätten organisiert. Zudem hatte man kein Konzept im Umgang mit dem auch in Afrika grassierenden Coronavirus parat.
16 Spieler von Gambia coronapositiv
Mithilfe des Weltverbands Fifa eröffnete die Caf daraufhin in Yaoundé kurzerhand ein eigenes Organisationsbüro, um die Dinge in die Hand zu nehmen. Neben allerlei organisatorischen Maßnahmen schaltete man sich ganz schnell in die unbeantworteten Coronafragen ein, deren fehlende Antworten vor allem die europäischen Klubs vehement moniert hatten. Resultat: Die Spieler werden sich in von außen undurchdringlichen Blasen bewegen müssen, in den Stadien werden nur komplett Geimpfte zugelassen. Heißt: Die Spiele werden nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, denn in Kamerun sind lediglich etwa drei Prozent der Bevölkerung gegen das Virus geimpft.
Dass das Virus dennoch ein gewichtiges Wort auch in der sportlichen Entwicklung des Turniers spielen könnte, wurde wenige Tage vor Beginn bereits deutlich. Außenseiter und Turnierdebütant Gambia musste ein für Anfang Januar in Doha geplantes Vorbereitungsspiel gegen Algerien kurzerhand absagen. Gleich 16 Spieler des 25-köpfigen Kaders waren positiv auf das Virus getestet worden. Mit welcher Besetzung die Mannschaft des belgischen Trainers Tom Saintfiet am 12. Januar zum ersten Gruppenspiel gegen Mauretanien antreten wird, steht noch in den Sternen.
Dabei darf man sich beim Afrika-Cup eigentlich traditionell vor allem auf das Auftreten der – meist schillernden – Außenseiter am meisten freuen. Schon 2019, als das Turnier erstmals mit 24 statt 16 Mannschaften durchgeführt wurde, hatten es „Zwerge“ wie Burundi, Madagaskar und Mauretanien zum Endturnier geschafft. Diesmal ist das Gambia und den Komoren gelungen. Während der Turniersieg mutmaßlich zwischen den Favoritenteams Algerien (mit Manchester Citys Riyad Mahrez), Ägypten mit Mo Salah und Senegal (Sadio Mané) ausgespielt wird, sind es gerade diese kleinen Teams, deren Geschichten besonders hervorstechen.
Das Inselarchipel der Komoren hat zum Beispiel nur um die 850.000 Einwohner, die weit verstreut auf irgendwelchen Landflecken im weiten Ozean leben. Zum fußballerischen Leben erweckt wurde die Inselgruppe vom in Frankreich geborenen 49-jährigen Amir Abdou, der das Team 2014 übernahm und völlig neu zusammenstellte. Fußballlehrer Abdou, der „nebenbei“ auch noch das mauretanische Vereinsteam FC Nouadhibou trainiert, schaute sich europaweit nach Spielern mit komorischen Wurzeln um und wurde tatsächlich fündig – wenn auch nur in der zweiten und dritten Liga Frankreichs.
Abdou arbeitet mit dem Nationalteam wie mit einer Vereinsmannschaft: Seit fünf Jahren hat er immer nahezu die gleichen Spielern zusammen, der Kader wurde seither kaum einmal verändert. Dadurch haben sich in teils wochenlangen Trainingslagern Automatismen und ein Zusammenhalt entwickelt, die spielerische Nachteile mehr als wettmachen.
Das Team konnte sich so in den Qualifikationsspielen für den Cup gegen Größen wie Kenia und Togo durchsetzen. In Kamerun wurden die Komoren in eine Gruppe mit den erfahrenen afrikanischen „Schwergewichten“ Gabun, Marokko und Ghana gelost. Eigentlich nicht zu schaffen für die Inselspieler. Aber Trainer Abdou gibt sich zuversichtlich: „Wir sind nicht zufällig qualifiziert. Wir glauben daher nicht, dass wir uns die Gelegenheit entgehen lassen, so weit wie möglich zu gehen. Wir werden mit unseren Waffen gegen unsere verschiedenen Gegner kämpfen, so hart sie auch sind. Fußball ist auf dem Platz.“